Der Digitalpakt der Amerikaner war vor 20 Jahren
Wieso sind die deutschen Schulen bei der Digitalisierung so weit hinterher? Was muss die Bildungspolitik tun, um den Rückstand aufzuholen? Und warum ist eine bundesweite Schulcloud eine Utopie? Der Bildungsinformatiker Andreas Breiter stellt sich sich meinen Fragen – in der ersten Folge der Podcast-Reihe "Wiarda wundert sich".

ICH FREUE MICH SEHR über Ihr Interesse am Podcast "Gipfel der Bildung", den ich gemeinsam mit Patrick Honecker im Frühjahr gestartet habe. Die nächsten Folgen mit spannenden Gesprächspartnern sind schon auf dem Weg. Wie angekündigt beginnt nun auch mein zweites Podcast-Format: "Wiarda wundert sich". Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema.
Zum Auftakt habe ich Andreas Breiter getroffen. Er ist Professor für Angewandte Informatik und Direktor des Instituts für Informationsmanagement (ifib) an der Universität Bremen. Seit vielen Jahren erforscht er den Umgang mit Informationen und neue Formen des Lernens im digitalen Zeitalter, national wie international. Den Digitalpakt und seine Umsetzung hat er vom Anfang an kritisch-konstruktiv begleitet.
Zuletzt hat Andreas Breiter im Auftrag der Telekom-Stiftung die erste systematische Bestandsaufnahme der schulischen Lernplattformen aller Bundesländer und von fünf Großstädten vorgenommen – mit teils überraschenden, teils auch ernüchternden Ergebnissen.
Warum eine bundeseinheitliche Schulcloud weder wahrscheinlich noch nötig ist, warum es nicht überraschend ist, dass der Digitalpakt so schleppend verläuft und wie Bund und Länder den enormen Rückstand der deutschen Schulen im internationalen Vergleich aufholen können – Wiarda wundert sich, Breiter antwortet.
Und Andreas Breiter stellt selbst Fragen. Denn das ist das Besondere am Fragensteller-Podcast. Auch Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer sind gefragt, diskutieren Sie mit!
Am Ende des Gesprächs will der Bildungsforscher wissen:
a) Wie und wo können wir die vielen Beispiele von Schulen, wo es bereits gut klappt mit der digitalen Bildung, zusammentragen und für alle übrigen sichtbar und öffentlich machen?
b) Wie können wir dafür sorgen, dass alle Regionen in Deutschland bei der Digitalisierung von Schule und Unterricht mitkommen und keine abgehängt wird? Wie können wir die Schulregionen stärken?
Sie haben Gedanken dazu? Eine Idee? Schreiben Sie sie auf – hier in der Kommentarspalte, so dass alle etwas davon haben.
Kommentare
#1 - Die 2018 in Baden-Württemberg gescheiterte…
Das Folgeproblem bestand aber nicht darin, dass es keine Plattform gab, sondern im Wildwuchs durch eine Vielzahl unterschiedlichster (Not-)Lösungen.



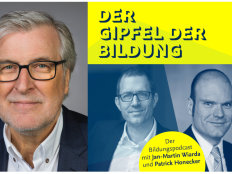



Neuen Kommentar hinzufügen