Wer sagt hier zentral?
Karliczek, Söder, Eisenmann: Was die Debatte übers Abitur verrät und warum die Länder jetzt die letzte Chance haben, ihren Bildungsladen selbst in Ordnung zu bringen. Ein Essay.
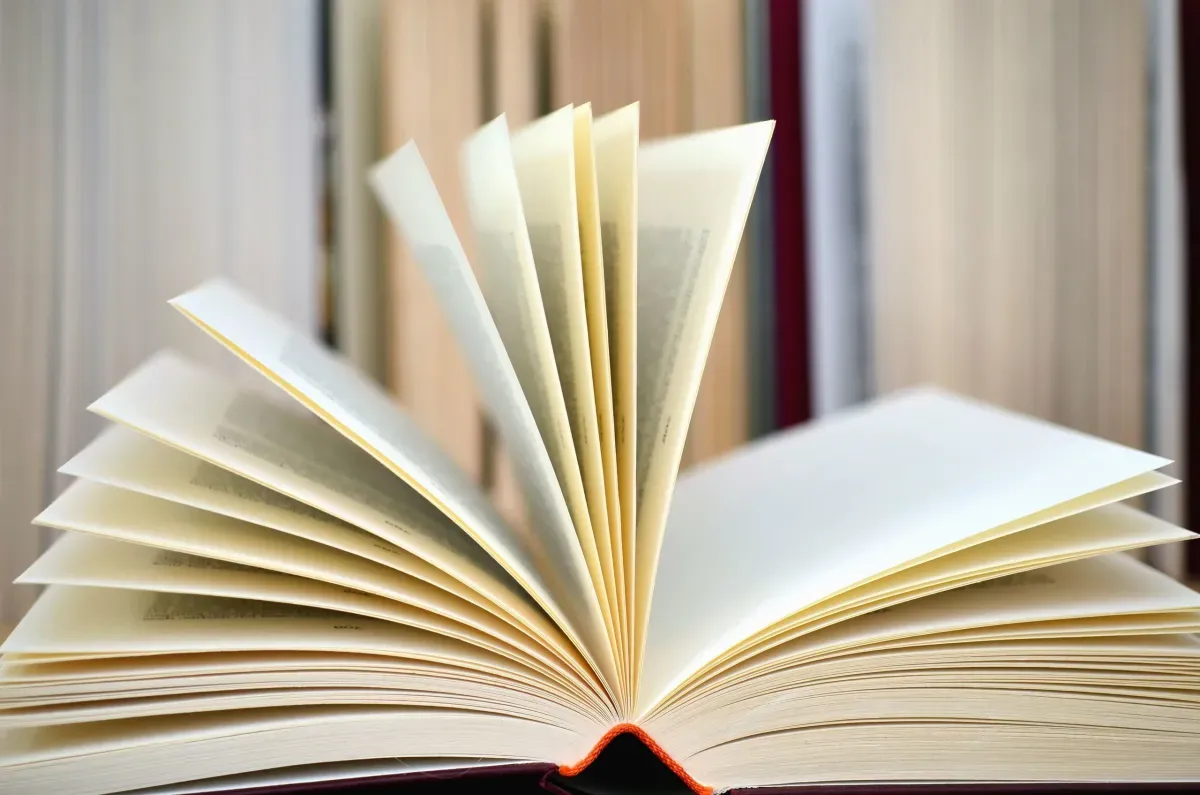
Foto: congerdesign / pixino - cco.
BAYERNS MINISTERPRÄSIDENT Markus Söder widerspricht Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann – und zeigt mit wenigen Sätzen, dass er ihren Vorschlag nicht verstanden hat. Ein Zentralabitur werde es mit der CSU nicht geben, sagte Söder dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Zentralismus führe immer nur zu einer Schwächung. Und: "Mit der Grundidee, dass ein Abitur aus Berlin gestaltet wird, tun wir uns keinen Gefallen."
Die CDU-Politikerin Eisenmann hatte vergangene Woche mit ihrer Wortmeldung für Furore gesorgt. "Wir brauchen in Deutschland innerhalb von fünf bis zehn Jahren ein zentrales Abitur und auch für andere Schulabschlüsse zentrale Prüfungen", sagte sie, ebenfalls dem RND. Am Ende müsse es nicht nur deutschlandweit dieselben Prüfungsaufgaben geben, "sondern auch einheitliche Regeln dafür, welche Fächer ins Abitur eingebracht werden".
Von einem aus Berlin gestalteten Abitur sagte Eisenmann nichts. Zu Recht. Denn das, was sie da beschreibt, sind keine Schulabschlüsse, die von einer übergeordneten Bundesmacht dekretiert werden. Sie will, dass sich die Länder von selbst und aus eigener Stärke heraus auf Standards verständigen. Weil sie sich sonst, wie sie hier im Blog sagte, "in der Bildungspolitik überflüssig machen". Ihren Vorschlag kann man als Flucht nach vorn verstehen, um den Bildungsföderalismus zu retten. Genau das hat Söder nicht verstanden. Woran Eisenmann allerdings eine Mitverantwortung trägt: Der Begriff "Zentralabitur" leitet auf eine falsche Fährte.
Söders atemberaubend unpräzise Aussage
Söders atemberaubend unpräzise Aussage, Zentralismus führe immer nur zu einer Schwächung, würde Eisenmann dabei sogar unterschreiben. Denn die Angst vor aus ihrer Sicht überflüssigen zentralistischen Tendenzen hat sie überhaupt erst auf den Plan gerufen: Die Große Koalition im Bund will einen Nationalen Bildungsrat gründen, um mehr Vergleichbarkeit ins Bildungssystem zu bringen, die Verhandlungen mit den Ländern stehen kurz vor dem Abschluss, obwohl die meisten Kultusminister den Rat ursprünglich gar nicht wollten. Die besonders Skeptischen sehen in ihm eine selbstgerechte Moralinstanz, die angesichts der Kultushoheit der Länder, faktisch machtlos wäre, ihnen aber jede Menge Arbeit machen würde.
Doch die Länder stehen unter Einigungsdruck. Symbolische Zugeständnisse sind gefragt. Weite Teile der Öffentlichkeit sehen das nämlich so: Die Kultusminister haben sich in Sachen Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen, Prüfungen und schulischen Leistungsniveaus über die Jahre derart blamiert, dass sie eindeutig bewiesen haben: Sie bekommen es allein nicht hin. Dieses Image ist die größte und die eigentlich reale Gefahr für den Bildungsföderalismus. Einheitlichere Prüfungen sind es ganz sicher nicht.
Bestes Beispiel waren zuletzt die sogenannten Abituraufgabenpools, die die Länder gemeinsam speisen, unter Federführung des von ihnen getragenen Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB). An sich eine hervorragende Idee. Seit zwei Jahren entnehmen die meisten Länder aus den Pools einige Abiaufgaben in Mathe, Deutsch, Englisch und Französisch. Aber eben nicht alle Länder. Jedes Land entscheidet auch selbst, wie viele Aufgaben es zieht. Bislang durfte es die Formulierung der Fragen dann sogar noch an die eigene Schulpraxis anpassen. Und als diesen Sommer bundesweit Abiturienten protestierten, die Pool-Aufgaben seien zu schwierig gewesen, setzten manche Länder die Noten rauf. Andere dagegen nicht.
Wenn man sich die Abi-Aufgabenpools verpflichtend denkt,
ist man bei Eisenmanns Vorschlag
Unter den Kultusministern, also den willigen, setzt sich zuletzt mehr und mehr die Ansicht durch, dass die Pools so, wie sie aufgesetzt sind, womöglich eine Sackgasse darstellen. Selbst wenn man von der weiteren allmählichen Annäherung der Länder ausgeht, wie sie derzeit geplant ist, denn die wird nicht reichen. Wenn man sich die Aufgabenpools allerdings verpflichtend denkt – alle Länder müssten zumindest in den Hauptfächern alle Aufgaben daraus ziehen, sie dürften sie nicht mehr verändern, und die Benotung wäre einheitlich – dann könnte die Pool-Idee doch noch funktionieren. Nur dass es dann eigentlich kein Pool mehr wäre. Sondern ein einheitliches Abitur, das man, wenn man zuspitzt, Zentralabitur nennen könnte.
Aber würde so, auch wenn Eisenmann das nicht will, am Ende nicht doch der (wenn auch nicht vom Bund gesteuerte) Zentralismus in die Bildungspolitik einziehen? Und ist nicht der beste Beleg dafür, dass zuletzt ausgerechnet Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) Eisenmann Beifall spendete und der Stuttgarter Zeitung sagte, ein Zentralabitur sei "eine Frage der Gerechtigkeit"?
Eisenmann selbst sagte im Interview ebenfalls mit der Stuttgarter Zeitung, damit ihr Vorschlag funktioniere, "brauchen wir auch vergleichbare Lehrpläne". Ihr Kollege Helmut Holter, linker Bildungsminister in Thüringen, sieht in einem bundesweiten Abitur, wenn man die Idee zu Ende denkt, gar viel weitreichendere Konsequenzen für den Bildungsföderalismus, als die Grundgesetzänderung wegen des Digitalpakts zu Anfang des Jahres sie gehabt habe. Eine Grundgesetzänderung, die Eisenmann übrigens ablehnte, weil sie die Kultushoheit eingeschränkt sah.
Die letzte Chance, den Bildungsladen selbst in Ordnung zu bringen
Holter sagte hier im Blog, würde Eisenmanns Vorschlag Wirklichkeit, müssten alle Lehrpläne in Deutschland aufeinander abgestimmt sein, "zumindest in der Sekundarstufe I und II, weil Abiturienten alle die gleichen Aufgaben erhalten und die gleichen Chancen haben müssen, sie zu lösen".
Interessanterweise sagt ausgerechnet Forschungsministerin Karliczek, dass sie keine identischen Lehrpläne wolle, "aber gemeinsame Zielvorstellungen". Dafür brauche es unter anderem den Bildungsrat, den Eisenmann ablehnt. Bildungspolitik, sagte Karliczek, solle aber Ländersache bleiben.
Eigentlich ist es ganz einfach: Die Länder erleben gerade ihre letzte Chance, den Bildungsladen selbst in Ordnung zu bringen. Womöglich müssen sie ihren eigenen, selbst gesteuerten Zentralismus schaffen, um den Zentralismus von oben zu verhindern. Womit ausdrücklich nicht der Bildungsrat gemeint ist. Der hat, da kann man Karliczek nur zustimmen, so oder so seinen Sinn. Einen neuen Staatsvertrag für die Kultusministerkonferenz haben die Ressortchefs längst versprochen. Am Ende wird da aber auch etwas Wegweisendes drinstehen müssen.






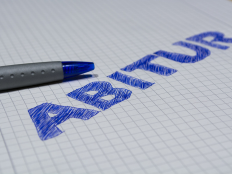

Neuen Kommentar hinzufügen