Mehr Overhead, weniger Projekte
Ein Papier mit Sprengkraft: Wie der Wissenschaftsrat die deutsche Forschungsfinanzierung verändern will.

Titelseite des Positionspapiers. (Screenshot)
SCHEUT DER WISSENSCHAFTSRAT, dieses einzigartige Beratungsgremium von Wissenschaft und Politik, in der Krise den Konflikt? Oberflächlich betrachtet könnte man dieser Meinung sein angesichts des Positionspapiers zu den Strukturen der Forschungsfinanzierung, das er kürzlich verabschiedet hat. Denn wer darin die ultimativen Forderungen nach mehr Geld sucht, wird enttäuscht.
Im Gegenteil, von immer neuen Steigerungen der Forschungsbudgets könne nicht mehr selbstverständlich ausgegangen werden, betont das Gremium, es gehe darum, Forschungsfinanzierung "krisenfester" zu machen. Der Ansatz sei gewesen, sagt der neue Wissenschaftsratsvorsitzende Wolfgang Wick, "die Strukturen der Forschungsfinanzierung zu verbessern, um die vorhandenen Mittel möglichst effektiv und effizient einzusetzen".
Die Politik hört so etwas sicher gern. Und wer die Funktionsweise des Wissenschaftsrats kennt, dieses wichtigsten wissenschaftspolitischen Beratungsgremium von Bund und Ländern, der weiß: Ohne Zustimmung der Politik geht hier gar nichts.
Ohne Zustimmung der Wissenschaft allerdings auch nicht. Und wer glaubt, es handelt sich deshalb um zahme Empfehlungen, die der Wissenschaftsrat da formuliert hat, übersieht deren Sprengkraft.
Wenn das Gremium etwa feststellt, dass die immer weitere gewachsene Projektfinanzierung zulasten der Grundmittel der Hochschulen gehe, ist das nicht nur eine Kritik der Wissenschaft an der Politik. Es ist ein Eingeständnis der Politik selbst, mit ihrem bisherigen Ansatz an einem toten Punkt angelangt zu sein. Was womöglich auch erklärt, warum sich das BMBF (als direkter und indirekter Haupt-Drittmittelgeber) mit der Zustimmung so schwergetan hat, dass die eigentlich für Oktober vorgesehen Beschlussfassung des Papiers verschoben werden musste – und bis zuletzt nicht sicher war, ob es diesmal klappen würde.
Zugleich bedeuten die Vorschläge, auf die Wissenschaft und Politik sich verständigt haben, das, was die FAZ als "Fehdehandschuh an die Drittmittelkönige" bezeichnet hat. Die Empfehlung, die (bislang nur von Deutscher Forschungsgemeinschaft und BMBF gezahlten) Programmkostenpauschalen sukzessive von 22 auf 40 Prozent der Drittmittelkosten zu erhöhen, und zwar "in diesem Jahrzehnt", ist dabei noch am wenigsten spektakulär. Denn ähnliche Forderungen werden seit Jahren immer wieder aus der Wissenschaft heraus erhoben. Allerdings bislang fast immer mit dem Verständnis, dass eine solche Erhöhung nicht zulasten der Zahl und Finanzierung der Drittmittelprojekte an sich gehen würde. Diesmal nicht: Es werde insgesamt weniger Projekte geben, sagte Wissenschaftsratsmitglied Jürgen Heinze. "Das nehmen wir in Kauf."
Am Ende der Reform stünde ein Paradoxon
Und das vor dem zusätzlichen Hintergrund, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft gerade auf Druck unter anderem des Bundesrechnungshofs die Hochschulen zu Leitlinien zur bestimmungsgemäßen Verwendung der DFG-Programmpauschalen verpflichtet. Darunter die Bestimmung, dass die erfolgreichen Projektantragstellern keinen direkten Zugriff mehr auf die Pauschalen erhalten. Was, wie der Wissenschaftsrat betont, ein "Umdenken auf Seiten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler" erfordert. Anders formuliert: Auch das müssen die Drittmittelkönige schlucken, zumal der Wissenschaftsrat empfiehlt, die Leitlinie sogar auf die "Pauschalen anderer Geldgeber", auszuweiten. Womit vor allem das BMBF gemeint ist.
Am Ende stünde der vom Wissenschaftsrat angestrebten Reform stünde ein Paradoxon. Auf der einen Seite eine egalitärere und transparentere Forschungsfinanzierung, weil die eingeworbenen Forschungsprojekte mit ausreichend hohen Pauschalen kämen, um alle Nebenkosten, den sogenannten Overhead, zu finanzieren. Anstatt wie derzeit mit ihrem Ressourcenbedarf die Substanz und Infrastruktur der Hochschulen und damit die allen zustehenden Forschungsgrundmittel anzufressen. Und die Pauschalen würden noch dazu zentral von der Hochschule verwaltet. Zugleich aber, und das ist die andere Seite, würde die Ungleichheit in der Forschungsfinanzierung noch größer – weil sich weniger Projekte auf weniger erfolgreiche Antragsteller verteilen würden. Die FAZ stellt hier den Drittmittelkönigen den "verarmten Grundmitteladel" gegenüber.
Neu austarieren müssen sich auch die auch Bund und Länder in ihrer Forschungsfinanzierung. So zahlen die Länder zwar 42 Prozent des DFG-Budgets, aber nur zwei von derzeit 22 Prozentpunkten Overhead-Pauschale. Das dürfte spannungsreiche Diskussionen in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz geben – etwas, das der Wissenschaftsrat nur andeutet.
Indirekt ist die Forderung nach mehr Geld übrigens dann doch im Papier enthalten – wenn das Gremium allen Forschungsförderern, die bislang keine Pauschale zahlen, die Einführung selbiger nahelegen – und dann bitte gleich bei besagten 40 Prozent.
Nein, dieses Papier ist keine Kapitulation der Wissenschaft vor der Politik, es sind in diplomatische Formulierungen verpackte gegenseitige Zumutungen. "Auch strukturelle Veränderungen können für verschiedene Seiten schmerzhaft sein und müssen sorgfältig ausgehandelt werden", sagte Wolfgang Wick direkt nach Verabschiedung des Papiers. Recht hat er.
Dieser Kommentar erschien heute in kürzerer Fassung zuerst im ZEIT-Newsletter Wissen3.
Kommentare
#1 - Freud'scher Verschreiber:"ist eine Kapitulation der…
"ist eine Kapitulation der Wissenschaft vor der Politik"
VG, FB
#2 - Danke für den Hinweis, ist korrigiert. Und bei allen Ehren…
#3 - Ich höre mich an wie eine festhängende Schallplatte, weil…
#4 - Zitat: "Zugleich aber, und das ist die andere Seite, würde…
Man kann das auch positiv sehen. Es käme endlich in der Mehrzahl nur noch zu Projekten mit Substanz, bei denen Drittmittelgeber also bereit ist, sich finanziell wesentlich höher zu engagieren, weil etwas substantielles zu erwarten ist. Das ist bei vielen Kooperationsprojekten mit der Industrie heute eben grade nicht der Fall. Die Projektpartner steigen nur ein, weil es sie wenig kostet, weil sie Nachwuchs abgreifen können und weil es gut für die Presse ist. Prima, wenn das zusammengestrichen wird. Auf die Vielzahl der damit verbundenen Promotionsprojekte kann man auch gut verzichten.

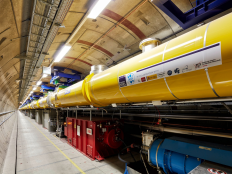






Neuen Kommentar hinzufügen