Fünf Milliarden, Erleichterung und viel Erwartungsdruck
Bund und Länder besiegeln offiziell den Digitalpakt 2.0 Was er beinhaltet – und wie die Minister jetzt über neue Formen der föderalen Zusammenarbeit verhandeln.

Kein Triumph, sondern Erleichterung: Bundesbildungsministerin Karin Prien (zweite von links) und ihre Länderkolleginnen Christine Streichert-Clivot, Simone Oldenburg und Dorothee Feller (von links). Foto: Claudia Gerloff / Bildungsministerium MV.
DER BESCHLUSS WAR GEFASST, die Digitalpakt-Fortsetzung einstimmig besiegelt, als sich im Länderzimmer 2 des Berliner KMK-Sekretariats die Türen zur Pressekonferenz öffneten. "Man hat es vielleicht gehört: Uns ist heute ein Stein vom Herzen gefallen", sagte Simone Oldenburg (Linke), die diesjährige Präsidentin der Bildungsministerkonferenz (BMK), nachdem sie neben Bundbildungsministerin Karin Prien (CDU) vor der Wand mit dem KMK-Logo Platz genommen hatten.
Fünf Milliarden Euro, fünf Jahre Laufzeit, Start zum 1. Januar 2025: Der Abschluss gelang fast zwei Jahre, nachdem die Verhandlungen um den Digitalpakt 2.0 begonnen hatten. Da war noch Bettina Stark-Watzinger (FDP) Bundesbildungsministerin, und Karin Prien gehörte zu den Wortführerinnen der Länderseite. Dazwischen lagen föderale Verhärtungen, offene Finanzierungsfragen, ein vorzeitiger Koalitionsbruch. Und – vor genau einem Jahr – endlich eine Grundsatz-Einigung mit Stark-Watzingers Kurzzeit-Nachfolger Cem Özdemir (Grüne). Danach verging erneut Monat um Monat: Bundestagswahl, Ressortneuordnung, Haushaltsaufstellung.
Insofern gab es bei der Pressekonferenz am Donnerstagmittag auch keine Hochgefühle, keinen Triumph. Und keine feierliche Unterzeichnungszeremonie, weil jetzt erst noch die Landesparlamente und Kabinette befasst werden müssen, bevor die politische Einigung rechtsbindend ist. Es gab Erleichterung und Mineralwasser auf dem Tisch.
Dass der Digitalpakt 2.0 kein bloßer Vollzug der Özdemir-Einigung ist, war Karin Prien denn auch als Botschaft wichtig. Die sei ein "erster Schritt" gewesen, eben nicht mit finanziellen Mitteln unterlegt gewesen. Auch handle es sich bei der gefundenen Bund-Länder-Vereinbarung nicht einfach um eine Fortsetzung des ersten Digitalpakts, sondern er enthalte "erhebliche qualitative Verbesserungen" – und das entlang von drei Handlungssträngen.
Erleichterung ohne Euphorie
Erstens die digitale Infrastruktur: Geräte, Netze, Server, Software – aber erstmals ausdrücklich auch IT-Administration, Support und Beratung. Der Bund finanziert diesen Handlungsstrang mit bis zu 2,25 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Mit Blick auf Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit sollen flächendeckende Technik und eine sichere IT-Infrastruktur bereitgestellt werden. Neben der Ausstattung sei vor allem die IT-Administration entscheidend, damit Lehrkräfte unterrichten können, sagte NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller, die als Koordinatorin der Unions-Bildungsminister auf dem Podium saß.
Zweitens die Schul- und Unterrichtsentwicklung: Medienbildung, pädagogische Konzepte, rechtssicherer Einsatz digitaler Werkzeuge – ausdrücklich auch von Künstlicher Intelligenz. Zudem sollen die Aufgaben- und Prüfungskultur weiterentwickelt, die pädagogische Professionalität der Lehrkräfte gestärkt und ein moderner Führungsstil gefördert werden. Dieser Teil liegt vollständig bei den Ländern, die ihre bestehenden Programme als Eigenanteil anrechnen dürfen.
Drittens 250 Millionen Euro für eine Bund-Länder-Initiative "Digitales Lehren und Lernen": Forschung, Transfer, fünf thematische Forschungsverbünde, eine zentrale Transferstelle. Ziel ist, wie Prien sagte, die Forschung schneller an die Schulpraxis heranzubringen, eine engere Kooperation zwischen den Ländern zu etablieren und wissenschaftliche Impulse kontinuierlich in die Praxis einzuarbeiten – ein indirekter Verweis auf die aus EU-Mitteln finanzierte Vorgängerinitiative namens "Kompetenzzentren für Digitales Unterrichten", deren Wirkung Kritikern zufolge oft begrenzt blieb.
Neu ist auch der Verwaltungsmodus: pauschalierte Zuweisungen, weniger Einzelanträge, weniger Verwendungsnachweise. BMK-Präsidentin Oldenburg fasste es so zusammen: weniger Bürokratie, mehr Tempo. Das Geld soll schneller bei den Schulen ankommen – eine zentrale Lehre aus dem ersten Digitalpakt. Die Länder können ihre Anträge bis zum 31. Dezember 2030 einreichen; die Projekte müssen bis Ende 2032 abgeschlossen sein, länderübergreifende Vorhaben bis Ende 2033.
Viel weniger neues Geld
Doch bei aller demonstrativen Zufriedenheit bei den anwesenden Ministern bleibt es bei dem, was schon an der Özdemir-Einigung ernüchterte: Das Volumen des Digitalpakts 2.0 bleibt mit fünf Milliarden Euro schon nominal hinter dem Vorgänger (6,5 Milliarden inklusive aller Zusatzvereinbarungen) zurück, die Inflation noch gar nicht eingerechnet. Und frisches Geld gibt es noch deutlich weniger: Der von zehn auf 50 Prozent hochgeschraubte Länderanteil von 2,5 Milliarden Euro besteht zu zwei Milliarden Euro aus Anrechnungen bestehender Haushaltslinien, laufender Programme und bereits geplanter Maßnahmen. Effektiv fließen damit eher rund drei Milliarden Euro zusätzlich ins System.
Hier setzt die parlamentarische Kritik an. Anja Reinalter, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, sprach von einer historischen Chance, die vertan worden sei. Zwar bringe die Einigung endlich Planungssicherheit, und ein kleiner Pakt sei besser als keiner. Doch das Sondervermögen Infrastruktur sei nicht ausreichend genutzt worden. Zugleich betonte sie: Digitale Bildung bleibe eine Daueraufgabe, die dauerhafte Finanzierung brauche – nicht immer neue Übergangslösungen.
Noch grundsätzlicher fällt die Kritik von Christian Füller aus. Für den Bildungsjournalisten ist der Digitalpakt 2.0 vor allem eines: ein politisch geschrumpfter Kompromiss, kaschiert durch juristische Raffinesse. Dass die Länder keine zusätzlichen Schulden aufnähmen und kaum neues Geld mobilisierten, sei ein politisches Signal: Digitale Bildung habe schlicht keine Priorität. Stattdessen schleppten sie "Schuhschachteln mit alten Digital-Quittungen" an, kommentierte er am Donnerstagmorgen.
Die Landesminister argumentieren demgegenüber, sie investierten schon heute weitaus mehr in die digitale Bildung, als der Bund es mit 2,5 Milliarden Euro tue.
Kritisch sieht Füller auch zwei umfangreiche Fußnoten in den Vereinbarungen. Sie erlauben es, künftig unter engen Bedingungen auch Personal aus Digitalpakt-Mitteln zu bezahlen – befristet und begründet. Für die Ministerinnen ist das ein Fortschritt. Für Füller ein großes Fragezeichen.
"Reptilienfonds" und Systemkonflikte
Und dann ist da der Punkt, der über Haushaltsfragen hinausgeht: die sogenannten länderübergreifenden Vorhaben. Während der Digitalpakt Schule buchhalterisch ausläuft, lebten diese LÜVs weiter – mit einer Finanzierung von nochmals 112,5 Millionen Euro im Digitalpakt 2.0. Neu ist, dass sich für ein solches Vorhaben künftig mindestens zwölf Länder zusammenschließen müssen; über die Mittelvergabe entscheidet eine Lenkungsgruppe. Offizielles Ziel der länderübergreifenden Vorhaben ist eine stärkere Harmonisierung und Interoperabilität digitaler Systeme – auch, um Marktzugänge für EdTech-Anbieter zu erleichtern.
Füller dagegen spricht zugespitzt von einem "Reptilienfonds", aus dem ein quasi-staatlicher Digitalkoloss entstehe, der private EdTech-Anbieter an die Wand drücke. Die Branche, so seine Warnung, stehe vor einer Finanz- und Wettbewerbskrise, beschleunigt durch staatliche Plattformen wie Telli oder AIS.
Die Wortwahl ist drastisch. Doch sie markiert einen Konflikt, den auch Bildungsforscher zunehmend offen thematisieren. Olaf Köller, Ko-Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK), sagte kürzlich im Interview, es würden enorme Summen ausgeschüttet, "teilweise mehr, als die beteiligten Akteure in so kurzer Zeit überhaupt sinnvoll ausgeben können".
Das gelte auch für die "Kompetenzzentren für Digitales Unterrichten", die im Digitalpakt 2.0 durch die Initiative "Digitales Lehren und Lernen" abgelöst werden sollen. "Digitale Transformation gelingt nur im Zusammenspiel von Forschung, Entwicklung und enger Kooperation mit der Praxis, und das auf Dauer. Das bekommt man nicht in drei- bis fünfjährigen Projekten hin", warnt Köller. Die vier Kompetenzzentren, zusammengeschlossen im "Kompetenzverbund lernen:digital", hatten Köllers Kritik in einer Replik auf sein Interview in Teilen zurückgewiesen: Es seien "tragfähige Strukturen der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Wissenschaft und den Landesinstituten für Lehrkräftefortbildung" entstanden.
Die nächste große Aufgabe
Auf Nachfrage sagte allerdings auch Prien, die bisherigen Zentren seien ohne Beteiligung der Länder beschlossen worden und seien deshalb "sehr theoretisch" unterwegs gewesen. "Jetzt wird dieses Programm neu aufgesetzt." Wichtig sei, dass die Länder von Anfang an den Praxisbezug mitgestalten würden. "Deshalb hat das Ganze eine völlig andere Qualität als zuvor." Es sei zugleich ein Beitrag zu dem Ziel des Koalitionsvertrags, eine stärker anwendungsorientierte Bildungsforschung von Seiten des Bundes zu ermöglichen. Insofern sei das Programm "vielleicht sogar eine Blaupause für weitere Vorhaben".
Zu den Länderübergreifenden Vorhaben sagte NRW-Ministerin Feller, LÜV-Angebote wie der KI-Chatbot "Telli" würden von Schulen "dankbar angenommen", weil sie datenschutzkonform seien. Viele Effekte des Digitalpakts I würden erst jetzt sichtbar: "Solche Großprojekte brauchen Zeit." Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot, Koordinatorin der SPD-regierten Bundesländer, sagte, Tech-Unternehmen hätten immer auch ein Interesse an Daten. "Unsere Aufgabe ist es, Datenschutz und pädagogische Verantwortung zu sichern."
Fast beiläufig wirkte an diesem Tag das zweite große Thema – und doch dürften die angelaufenen Verhandlungen kaum weniger heikel werden.
Angesichts der dramatischen Ergebnisse des IQB-Bildungstrends im Oktober hatte Prien den Ländern "einen Schulterschluss aller Verantwortlichen" angeboten. Ihr Vorschlag: "ein kollaborativer Arbeitsprozess, orientiert an gemeinsamen Bildungszielen anstelle von Verantwortungsdiffusion". Sie sei "sehr froh", sagte sie nach der damaligen BMK-Sitzung, dass alle anwesenden Bildungsminister "einem solchen Arbeitsprozess auf Staatssekretärsebene sofort zugestimmt" hätten. Und sie fügte hinzu: "Es ist uns ernst, und es geht um viel."
Diese Arbeitsgruppe, so schilderte es Prien nun, habe seit Oktober sehr vertraulich gearbeitet. Nicht, um Öffentlichkeit zu vermeiden, sondern um über Zuständigkeitsgrenzen hinweg überhaupt sprechen zu können. Der IQB-Bildungstrend könne die Ursachen der Leistungsentwicklung kaum erklären – das liege außerhalb seines Auftrags. Genau dort aber beginne das politische Problem.
Deshalb nun der nächste Schritt: eine Klausurtagung im Januar, wiederum bewusst nicht öffentlich, mit wissenschaftlicher Begleitung. Dort sollen erstens die vorhandenen Instrumente des Bildungsmonitorings auf den Prüfstand, zweitens zentrale Ursachenhypothesen diskutiert werden – von sozialer Ungleichheit über Lehrkräftemangel bis zur Unterrichtsqualität.
Prien spricht von einem "zarten Pflänzchen"
Von einem "fragilen Pflänzchen" sprach die Bundesbildungsministerin, sichtlich darum bemüht, keine Abwehrreflexe in den Ländern hervorzubeschwören. Auf ihr Lieblingsthema messbarer föderaler Bildungsziele kam sie erst auf Nachfrage ausführlicher zu sprechen. Und das in maximaler Behutsamkeit. Sie plädiere persönlich für wenige, verbindliche Ziele, sagte sie – fügte aber sofort hinzu, dass völlig offen sei, ob eine Einigung gelinge.
Wenn nicht, wäre es ein bildungsföderaler Offenbarungseid, den sich eigentlich keiner leisten kann. Doch genau dieser Erwartungsdruck, angefacht zuletzt durch eine ifo-Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, führt auf Länderseite schnell zu Verhärtungen, die Prien offensichtlich so gering wie möglich halten will.
Zu Recht: Ihre Landeskolleginnen auf dem Podium betonten abermals die Bedeutung von Vertraulichkeit und geschütztem Raum. Man müsse wissenschaftliche Befunde ernsthaft diskutieren, ohne sofort in Rechtfertigungslogiken oder Länder-Rankings zu verfallen. Erst daraus sollen konkrete Arbeitspakete entstehen – zwischen den Ländern und, wo sinnvoll, gemeinsam mit dem Bund. Ziel sei es, der nächsten Kultusministerkonferenz Vorschläge vorzulegen, die über Absichtserklärungen hinausgehen. Christine Streichert-Clivot sagte: "Diese Form der Zusammenarbeit ist anders als das, was wir aus der Vergangenheit kennen. Das ist ein sehr gutes Signal für eine schnelle und wirksame Umsetzung."
So trafen an diesem Tag zwischen Bund und Ländern zwei Verhandlungsprozesse aufeinander. Der eine zum Digitalpakt 2.0 ist endlich abgeschlossen. Der andere zu den Lehren aus der IQB-Misere hat gerade erst begonnen. JMW
"Das ist ein Offenbarungseid"
Bei der BMK-Pressekonferenz kommt es zu einem ungewöhnlich offenen Dialog über die Erinnerungskultur.
Es war ein selten ungeskripteter Dialog der sich im zweiten Teil der Pressekonferenz der Bildungsministerkonferenz entspann. Bundesbildungsministerin Karin Prien hatte sich gerade verabschiedet, ihren Platz nahm Michel Friedman ein. Das Thema: Erinnerungskultur. Zuvor hatten Friedman und der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, auf Einladung der BMK mit den Ministerinnen und Ministern diskutiert. Nun wurde dieser Austausch öffentlich – und Friedman nahm kein Blatt vor den Mund.
Den Auftakt machte Simone Oldenburg. Sie erinnerte kurz daran, dass Erinnerungskultur und Demokratiebildung eines ihrer Schwerpunktthemen als diesjährige BMK-Präsidentin gewesen seien. Die Bildungsministerkonferenz habe intensiv mit Mahn- und Gedenkstätten zusammengearbeitet und beschlossen, die Empfehlungen "Erinnern für die Zukunft" aus dem Jahr 2014 zu überarbeiten. "Denn wir alle wissen: Unsere Demokratie steht auf tönernen Füßen", sagte Oldenburg. Ziel sei es, Erinnerungskultur und Demokratiebildung enger miteinander zu verbinden.
Als Friedman das Wort ergriff, veränderte sich der Ton. "Das Leben jüdischer Kinder in Deutschland ist so schlecht wie noch nie seit der Gründung der Bundesrepublik", sagte er. Jüdische Kinder erlebten nicht, "dass die Würde des Menschen unantastbar ist", sondern Beleidigungen und "teilweise auch Gewalt". Ihre Identität werde zurückgedrängt. "Sie erleben, dass sie nicht mehr als Menschen wahrgenommen werden, sondern zuerst als Juden." Das bezeichnete Friedman als "einen Offenbarungseid" für den Grundgesetz-Artikel 1.
Er verwies auf seine eigene Biografie als Sohn von Holocaust-Überlebenden und auf die Entscheidung seiner Generation, in Deutschland zu bleiben und diese Gesellschaft mitzugestalten. Diese Entscheidung werde heute erneut infrage gestellt. Jüdische Schulen seien "Ausdruck eines völlig gestörten Normalzustands", weil sie massiv von Polizei bewacht werden müssten. Kinder, die täglich von bewaffneten Polizisten begleitet würden, lernten: "Jemand will mich töten. Oder jemand will mich schlagen. Oder irgendetwas stimmt hier nicht. Ich gehöre nicht dazu."
"Haben wir eine Erinnerungskultur?"
Friedman kritisierte zudem schulische Praxis. Jüdische Schülerinnen und Schüler würden seit Jahrzehnten, wenn es um Israel gehe, angesprochen und müssten Stellung beziehen. "Das ist ein Paradigmenfehler." Seine Frage lautete: "Haben wir eine Erinnerungskultur? Oder reden wir sie uns nur ein?" Spätestens nach dem 7. Oktober müsse man feststellen: "Es hat Lernen stattgefunden. Aber nicht ausreichend in den Schulen." Verantwortung trügen "wir alle", parteiübergreifend. Der 7. Oktober müsse ein Einschnitt sein. "Nach jedem Anschlag gab es Sonntagsreden. Aber es gab keine nachhaltige Umsetzung in den Schulen."
An dieser Stelle meldete sich NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller zu Wort. "Vielen Dank für diese Worte", sagte sie. "Ich finde es beschämend, dass jüdische Schülerinnen und Schüler heute mit Angst in die Schule gehen müssen." Sie verwies auf zahlreiche Projekte, Wettbewerbe und Initiativen zur Gedenkarbeit, betonte jedoch: "Das bleibt eine Daueraufgabe." Feller nannte Beispiele wie "Schülerparlamente, Klassenräte, Gesprächskreise" und verwies darauf, dass bereits in Grundschulen Kinder lernten, zuzuhören und demokratische Rollen zu übernehmen.
Friedman widersprach. Wenn nur noch 50 oder 55 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die die Schule in Deutschland verließen, wüssten, "was Auschwitz ist", müsse man sich fragen, "welche Tiefe der Begriff Erinnerungskultur in den nächsten Jahren überhaupt noch haben kann". Das seien Zahlen, die man klären müsse; er wolle daraus "keine Bewertung machen", sondern eine Feststellung in den Raum stellen, "über die wir nachdenken müssen". Wer nicht wisse, was Auschwitz sei, könne "die Erinnerungskultur in Deutschland nicht tragen".
Antisemitismus sei zwar "kein ausschließlich deutsches Phänomen", habe hier aber "einen besonderen Ursprung". Erinnerungskultur dürfe deshalb nicht nur als Abwehr gegen Bedrohung verstanden werden, sondern sei "vor allem eine Lernmöglichkeit". Doch diese Lehre werde nicht konsequent umgesetzt – "bis hinein in den Bundestag". Problematisch sei, dass Kinder im Schulalltag mit antisemitischen Äußerungen konfrontiert würden und viele Lehrkräfte, auch in Leitungsfunktionen, solche Situationen nicht "so lösen, wie man sie demokratisch lösen sollte". Das wirke als Vorbild. Er wolle Lehrkräfte nicht pauschal überfordern, fügte Friedman hinzu. Doch wenn sie diese Kompetenz haben müssten, dann sei sie "in den letzten Jahren sehr selten umgesetzt worden".
"Ich bestreite den Erfolg"
Feller antwortete direkt. "Ich habe gesagt, dass wir uns kritisch hinterfragen müssen, ob wir in der Erinnerungskultur und auch in der Demokratiebildung bereits ausreichend weit sind", sagte sie. "Das sind wir sicherlich noch nicht." Doch gebe es viele Schulen und Lehrkräfte, die sehr engagiert in den Bereichen Erinnerungskultur und Demokratiekompetenz arbeiteten. "Wir müssen weiter daran arbeiten, wir müssen noch große Schritte gehen, darüber sind wir uns im Klaren. Aber wir müssen auch darauf achten, dass das, was bereits aufgebaut worden ist, gestärkt und weitergetragen wird."
Friedman blieb bei seiner Einschätzung. "Ich bestreite nicht die Leistung der Engagierten", sagte er. "Ich bestreite den Erfolg." Der Begriff Erinnerungskultur sei möglicherweise zu weich geworden.
Zum Abschluss äußerte sich Saarlands Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot. "Erinnerung beginnt bei jedem selbst", sagte sie, "bei der eigenen Familiengeschichte". Geschichtsunterricht dürfe "nicht abstrakt bleiben". "Alles hat vor unserer Haustür stattgefunden." Nachbarn seien verschwunden, Kinder deportiert worden, Menschen hätten weggeschaut. Zeitzeugen gingen verloren – "auf Opfer- wie auf Täterseite". Daraus ergebe sich Verantwortung auch für die zweite, dritte und vierte Generation.
Zugleich beschrieb Streichert-Clivot neue Herausforderungen: wachsende Widerstände aus Elternhäusern, Angriffe auf Lehrkräfte, eine stärkere Präsenz von Verschwörungsmythen, Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit. Demokratiebildung beginne schon in den Kitas. Aber sie sei für Pädagoginnen und Pädagogen schwieriger geworden.
Kein Raum für eine Fortsetzung
Es schien, als hätte Michel Friedman gern noch weiterdiskutiert. Doch der nächste Punkt auf der Tagesordnung der Pressekonferenz drängte. JMW

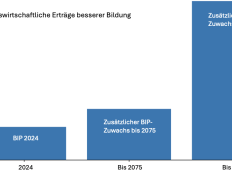



Neuen Kommentar hinzufügen