"Mehr Vielfalt, mehr Optionen, mehr Innovation"
Warum ein Losverfahren in der Forschungsförderung den Frauenanteil steigen lässt – und was die Daten außerdem noch verraten, das bislang kaum jemand auf dem Schirm hatte: ein Interview mit den Lübecker Forschern Sören Krach und Finn Lübber.
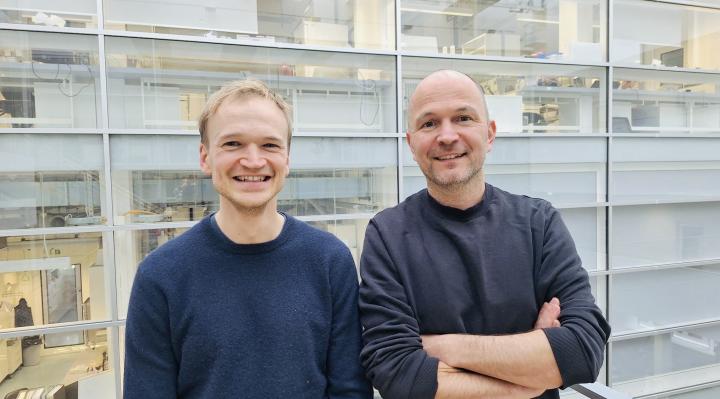
Sören Krach (rechts) leitet das Social Neuroscience Lab an der Universität Lübeck, Finn Lübber (links) ist Mitglied des Teams. Foto: A. Schröder.
Herr Krach, Herr Lübber, Sie haben gerade in "Nature Communications" eine Studie veröffentlicht, die viel Aufmerksamkeit bekommt: Eine vorgeschaltete Lotterie, gefolgt von einem Peer-Review-Verfahren, erhöht bei der Vergabe von Forschungsgeldern die Zahl weiblicher Bewerberinnen signifikant. Zudem steigt der Anteil geförderter Wissenschaftlerinnen, und der Zeitaufwand für Antragsteller, Gutachter und Verwaltung sinkt um zwei Drittel. Wie haben Sie das ermittelt?
Sören Krach: Der Ausgangspunkt war ein Kommentar in der Zeitschrift "Nature Human Behaviour", in dem wir vor zwei Jahren die These aufgestellt und mit Simulationen überprüft hatten, welchen Effekt eine frühe Lotterie auf Verzerrungen, Qualität und Kosten haben könnte. Nach der Veröffentlichung meldete sich ein Kollege aus Lübeck und sagte: "Ein solches Vergabeverfahren gibt es doch schon – die Stiftung Innovation in der Hochschullehre macht das praktisch genauso." Er stellte den Kontakt her, wir trafen uns, und aus diesem Zufall entstand die Idee, die Implementierung wissenschaftlich zu begleiten. Es war wirklich ein perfektes Match zwischen unserer theoretischen Überlegung und der realen Umsetzung.
Was war das für ein Vergabeverfahren?
Krach: Es ging um die "Freiraum"-Ausschreibung der Stiftung. Im ersten Jahr lief sie noch nach dem Prinzip "First come, first served" – gedeckelt auf 500 Anträge. Das führte zu Frust, weil manche eben schon fertige Anträge in der Schublade hatten und schneller waren als andere. Als Konsequenz stellte die Stiftung auf eine frühe Lotterie um. Mehr als 5.000 Personen meldeten Interesse an, 500 wurden per Los gezogen und durften dann einen Vollantrag einreichen. Dieses Setting haben wir im nächsten Durchgang dann evaluiert.
Die Ergebnisse, die Sie berichten, sind in der Tat bemerkenswert. Der Frauenanteil unter den Antragstellenden stieg nach Einführung der frühen Lotterie von 41 Prozent auf 45 Prozent. Und unter den Geförderten von 38 auf 47 Prozent. Wie erklären Sie, dass schon die reine Teilnahme so stark ansteigt?
Krach: Weil die Entscheidung, an einem normalen Antragsverfahren teilzunehmen, immer auch etwas mit den vorhandenen Ressourcen zu tun hat: Habe ich überhaupt die Zeit, zwei oder drei Monate in einen Antrag zu investieren– bei einer realistischen Erfolgschance von vielleicht zehn Prozent? Diese Investition können oder wollen manche Personengruppen weniger leisten. Und dazu gehören statistisch häufiger Frauen. Die frühe Lotterie verlangt dagegen zunächst nur eine Interessenbekundung mit 1.500 Zeichen, ein Aufwand von wenigen Minuten. Wird man ausgelost, steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit auf rund 30 Prozent. Eine geringere Einstiegshürde und höhere Chancen: Das motiviert Menschen, die durch die üblichen Verfahren benachteiligt sind.
"Die frühe Lotterie verschiebt die Zusammensetzung der Bewerbungen – und das wirkt sich dann automatisch auch auf die Förderung aus."
Und die 47 Prozent geförderter Frauen – also diese neun Prozentpunkte mehr – erklären Sie durch weniger Verzerrungen als im klassischen Review-Verfahren?
Finn Lübber: Wir konnten das Review-Verhalten selbst nicht analysieren, weil wir keinen Zugriff auf die Vollanträge und Gutachten hatten. Aber es gibt internationale Forschung, die genau das zeigt: In vielen Fächern und Begutachtungsprozessen sind Frauen benachteiligt. Bei der "Freiraum"-Ausschreibung aber liegt der größte Effekt tatsächlich in der Teilnahme selbst: Die frühe Lotterie verschiebt die Zusammensetzung der Bewerbungen – und das wirkt sich dann automatisch auch auf die Förderung aus.
Haben Sie ähnliche Muster für andere Gruppen gesehen – etwa Forschende aus Einwandererfamilien oder mit internationalem Hintergrund?
Krach: Hätten wir gern. In Deutschland ist es aber sehr schwer, die dafür nötigen personenbezogenen Daten datenschutzkonform zu erheben. Wir hatten darum nur Informationen bezüglich der Geschlechtsidentität. Und die Nationalität wäre als Unterscheidungsmerkmal wenig aussagekräftig gewesen, weil die Stiftung ausschließlich Lehrprojekte fördert, die wiederum zum großen Teil deutschsprachig sind. Außerdem sagt eine deutsche Staatsbürgerschaft natürlich nichts darüber aus, ob Menschen Rassismus oder andere Benachteiligungen erleben.
Eine Grundannahme Ihrer Untersuchung lautet: Wenn das Bewerberfeld vielfältiger wird, nutzt das dem wissenschaftlichen Fortschritt, daher profitieren nicht nur die weiblichen Antragsteller, sondern die Wissenschaft insgesamt. Lässt sich das durch die tatsächliche Qualität der Anträge belegen?
Lübber: Wir hatten wie gesagt keinen Zugriff auf die Inhalte der Anträge. Aber wir wissen aus der internationalen Literatur: Lotterien erhöhen die Vielfalt der Ideenpopulation. Menschen trauen sich eher, nicht-mainstreamige Projekte einzureichen, wenn sie wissen, dass ein Reviewer nicht sofort sagt: "Probieren Sie lieber etwas Konventionelleres." Und: Ein diverseres Bewerberfeld bringt zwangsläufig neue Perspektiven und Themen hinein. Das sind qualitative Effekte, die wir perspektivisch gern genauer beforschen würden.
Krach: Genau. Die Lotterie macht sichtbar, welche Ideen überhaupt auf den Tisch kommen. Viele dieser Ideen würden im klassischen System durchs Rost fallen. Das ist ein zentraler Wert: mehr Vielfalt, mehr Optionen, mehr potenzielle Innovation.
"Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist höher, der Anteil aussichtsloser Anträge geringer. Das reduziert die gesamtgesellschaftlichen Kosten enorm."
Ein für Fördermittelgeber sehr gewichtiges Argument ist der eingesparte Zeitaufwand bei allen Beteiligten. Aktuell leidet vor allem das Peer-Review-System unter einer ständigen Überforderung, Gutachterinnen und Gutachter sind Mangelware. Wenn Sie berichten, die geschätzten gesellschaftlichen Kosten sänken um rund zwei Drittel, ist das schon eine Ansage.
Lübber: Die in der bereits beschriebenen simplen, aber sehr wirkungsvollen Mechanik begründet liegt: Im klassischen System schreiben sehr viele Menschen sehr lange Anträge – und fast alle werden abgelehnt. Im Lotteriesystem wird der größte Teil dieser Arbeit gar nicht erst geleistet. Nur wer gezogen wurde, schreibt einen Vollantrag. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist höher, der Anteil aussichtsloser Anträge geringer. Das reduziert die gesamtgesellschaftlichen Kosten enorm. Und es bringt Planbarkeit: Eine Förderorganisation kann genau festlegen, wie viele Anträge begutachtet werden müssen. Das ist attraktiv.
Wenn die Vorteile nach Ihren Worten so auf der Hand liegen, warum sind Lotterien in der Fördermittelvergabe weiter die Ausnahme, warum herrscht hier immer noch so viel Skepsis in der Wissenschaft?
Krach: So groß war die Skepsis in unseren Befragungen gar nicht. Etwa die Hälfte der Beteiligten würde es dem klassischen Verfahren vorziehen. Tatsächlich beruht die Kritik oft auf einem Missverständnis: Viele denken, eine Lotterie sei per se ungerecht, weil ja dann die Qualität keine Rolle spielen würde. Aber das gilt ja in dem von uns untersuchten Verfahren gar nicht – im Gegensatz zur sogenannten "Tiebreaker"-Lotterie, mit der gerade international viel experimentiert wird in der Schweiz, in Großbritannien, Dänemark, Neuseeland, Australien.
Was ist der Unterschied?
Krach: Der Unterschied ist, dass dort die Lotterie am Ende des Prozesses ansetzt, nach dem Peer-Review-Verfahren. Dadurch kann der Eindruck von Ungerechtigkeit entstehen. Eine frühe Lotterie aber setzt vor dem Peer-Review-Verfahren an und verhindert, dass überhaupt Tausende Vollanträge geschrieben werden müssen. Über die geschriebenen Vollanträge jedoch entscheiden dann allein die Gutachterinnen und Gutachter.
Lübber: Wobei da das nächste Missverständnis vorliegt. Viele glauben, Peer Review wähle zuverlässig die besten Ideen aus. Die empirische Evidenz sagt aber etwas anderes. Peer Review ist wertvoll, aber keineswegs perfekt. Eine Lotterie kann diese Verzerrungen nicht beheben, aber wie beschrieben abmildern. Denkt man den Gewinn an Gerechtigkeit, Vielfalt und Kosten zusammen, sind die Vorteile offensichtlich.
Was haben Sie als nächstes vor?
Krach: Als nächstes wollen wir genau die offenen Fragen klären, über die wir gerade geredet haben. Wir sind in engem Austausch mit der Stiftung Innovation in der Hochschullehre und arbeiten bereits an der Planung der nächsten Förderperiode. Dabei wollen wir dann die geförderten Projekte auch inhaltlich systematisch untersuchen. Hält unsere Hypothese, dass die Qualität der Anträge nicht schlechter ausfällt, sondern wahrscheinlich sogar besser – weil riskantere, innovativere Ideen eine Chance bekommen und weil die Antragstellenden motivierter sind als in einem konventionellen Verfahren? Wir wollen es herausfinden.
Originalpublikation: Luebber, F., Krach, S., Paulus, F. M., Rademacher, L., & Rahal, R. M. (2025). Lottery before peer review is associated with increased female representation and reduced estimated economic cost in a German funding line. Nature Communications, 16(1), 9824.
Kommentare
#1 - Allerdings...
führt das Stil-Verfahren mit seinen reinen Interessensbekundungen bei uns auch zu einer Explosion der Anträge. Da jeweils eine Interessensbekundung pro Person möglich ist, werden in den Arbeitsgruppen noch die Hilfskräfte hervorgezerrt, um "eigene" Ideen einzureichen.
Ansonsten entnehme ich dem Interview genau EINEN Befund: am Losverfahren beteiligen sich Personen, die den Aufwand von längeren Anträgen scheuen (was gut verständlich ist). Sonst sehe ich im Interview viel "wir wissen es nicht, stellen es uns aber so und so vor "
#2 - Vergleichende Gutachten?
Wenn die Qualität der Gutachten als weitere Schwachstelle ausgemacht wurde, dann könnte der nächste Schritt die Einführung vergleichender Gutachten sein. Sogenanntes "comparative judgement", bei dem Gutachter:innen sich einige Male zwischen je zwei Skizzen entscheiden, funktioniert oft besser als die Vergabe fester Kategorien, die manchmal sehr grob sind und manchmal schwer anwendbar. Das Pech, einen besonders strengen Gutachter erwischt zu haben, wird in diesem Modus ausgeschlossen: er kann nie beide Optionen ablehnen sondern nur gegeneinander bewerten.
#3 - Bezahlte Gutachter?
Mir fehlt in dieser Darstellung auch die Analyse der Gutachter und Gutachterinnen: Warum schreiben sie Gutachten? Werden sie dafür bezahlt? Bin von meiner früheren Stipendienorganisation eingeladen worden als Gutachter tätig zu werden. Nachdem ich die unbezahlte Arbeit in meinem sowieso schon prekären 50% Wissenschaftsjob gesehen habe, habe ich dieses Ehrenamt dankend abgelehnt. Welche Wirkung hätte es, wenn man das Fachwissen von Gutachtern auch entsprechend honoriert und ihnen eine Aufwandsentschädigung für ihre Zeit geben wurde?
#4 - Gutachtenmangel
@#3: Ja, in anderen Ländern ist es auch üblich, dass für Gutachten eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Dann wäre es auch leichter, qualitativ minderwertige oder gar gegen die wiss. Integrität verstoßende Gutachten zu vermeiden...





Neuen Kommentar hinzufügen