Der Wissenschaftsjournalismus muss politischer werden
Warum sich Wissenschaftsjournalismus nicht länger auf Berichte aus Forschung und Labor beschränken darf – und welche politischen Aufgaben er übernehmen muss. Ein Plädoyer von Manfred Ronzheimer.
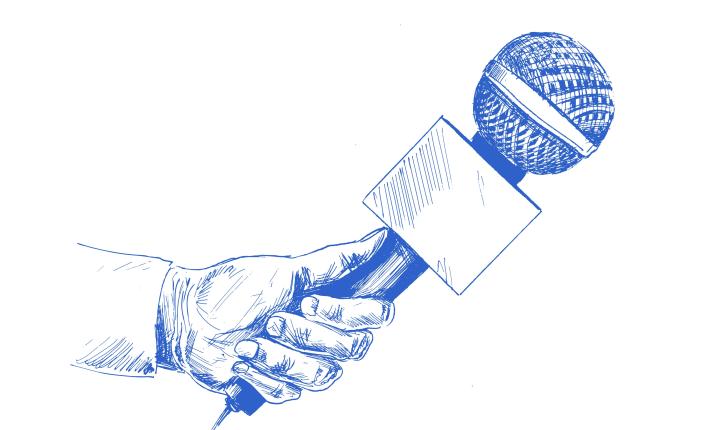
Bild: Rochak Shukla / freepik.
IN DIESER WOCHE findet an der FU Berlin die "Wissenswerte" statt, die jährliche Konferenz der deutschen Wissenschaftsjournalisten. Veranstaltet wird sie von der "Wissenschaftspressekonferenz" (WPK), der knapp 300 überwiegend hauptberufliche Wissenschaftsjournalisten angehören. In Vorträgen und Debatten werden aktuelle Themen der Berichterstattung aus Forschungsinstituten und Hochschulen behandelt. Doch einige Themen fehlen oder sind unterbelichtet. Die Frage stellt sich: Ist der Wissenschaftsjournalismus in Deutschland auf der Höhe der Zeit?
Deutschland befindet sich in der längsten Wirtschaftskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Export bricht ein, die Industrie baut ab, die Arbeitslosenzahlen steigen. Warum kommt die vormals ökonomische Lokomotive Europas nicht aus dem Knick? Eine exzellente Wissenschaft stünde für Zukunftslösungen bereit. "In diesem Land, das so viel Geld in seine Wissenschaft steckt, kommt hinten in Form von Innovationen zu wenig heraus", beklagt Hans-Hennig von Grünberg, Professor für Wissens- und Technologietransfer an der Universität Potsdam. Die Folge: Beim jüngsten europäischen Innovationsindex fiel Deutschland erstmals aus der Spitzengruppe der zehn Besten heraus.
Der Transfer hat offenbar ein Problem. Doch in diesem Problem steckt noch ein anderes, das hier angesprochen werden soll – ein kommunikatives. Grünberg trug seine Kritik Anfang voriger Woche auf einer Fachhochschulkonferenz in Berlin vor. Die Presse fehlte (bis auf einen Vertreter).
(1) Die punktuelle Absenz steht stellvertretend für eine permanente. Das Wissenschaftssystem und der Wissenschaftsjournalismus haben sich in den vergangenen Jahren auseinanderentwickelt. Journalisten besuchen kaum noch die Konferenzen der Wissenschaftler, schon gar nicht die Jahrestagungen ihrer Forschungsorganisationen. Vor allem das klassische Bindeglied zwischen beiden Welten, die Pressekonferenz, ist so gut wie zum Erliegen gekommen. Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer – alle laden längst nicht mehr zu Jahrespressekonferenzen ein, auf denen sie ihre Ergebnisse und Forderungen vorstellen.
(2) Die gewachsene Distanz zwischen Wissenschaft und Presse hat ihre Wurzeln in der Digitalisierung, die auf der einen Seite vor allem dem Erlösmodell der Printmedien den Boden entzog und zugleich deren Informationsmonopol beendete. Dies hatte medial einen Anstieg der Eigenkommunikation der Wissenschaftsorganisationen zur Folge (was positiv und negativ zu werten ist) und vor allem politisch einen Mangel an Kontrolle. Der heutige Wissenschaftsjournalismus hat die klassische Wächterfunktion aufgegeben und befasst sich nur noch in den seltensten Fällen mit Fehlentwicklungen in den Wissenschaften. Die Beispiele Neugebauer (Fraunhofer) und Stark-Watzinger (BMBF) sind Ausnahmen auf weiter Flur: Die Aufklärung begann zwar im Wissenschaftsjournalismus, wurde dann aber auch stark von den Politikressorts gecovert. Hinzu kommt: Die nicht auf Skandale ausgerichtete "Monitoring"-Funktion – das Begleiten der langen Entwicklungslinien der Wissenschaft (Frauenanteil, Ausgründungen, Dritte Mission) – gibt es überhaupt nicht mehr.
(3) Der Wissenschaftsjournalismus von heute ist Rosinenpickerei. Einzelne Journalisten schreiben über ihre Lieblingsthemen. Die großen Weltläufte und ihre epochalen Disruptionen werden nicht adäquat wahrgenommen und medial behandelt – weder im Überbau noch in der Basis des Berufs. Gemeint sind vor allem die großen Trends: Wissenschaftsfeindlichkeit, KI und Informationskrieg.
(4) Trotz der zunehmenden Verwissenschaftlichung der Lebenswelt und trotz der täglich publizierten Arbeitsprodukte der Wissenschaftsjournalisten hat vor allem seit der Corona-Pandemie der Anteil von Wissenschaftsgegnern in der Gesellschaft ständig zugenommen. Der Anti-Rationalismus ist fester Bestandteil des Rechtspopulismus, der sich auch in Deutschland verbreitet. In den USA ist ein Repräsentant dieser Geisteshaltung sogar Präsident geworden – mit schlimmen Folgen für das US-Wissenschaftssystem. Darüber muss aber nicht nur wie gewohnt berichtet werden, vielmehr müssten vom Wissenschaftsjournalismus mediale Gegenstrategien gegen Desinformation und Verschwörungstheorien entwickelt werden. Das tut er bislang nicht.
(5) Künstliche Intelligenz ist ein schickes aktuelles Thema für den Wissenschaftsjournalismus, wird aber viel zu unkritisch behandelt – gerade auch, was die Grundlage des eigenen Arbeitens angeht. Die Frage "Macht künstliche Intelligenz den Journalismus kaputt?" steht im Raum. KI könnte "eine existenzielle Bedrohung für viele Redaktionen" darstellen. Trotzdem gibt es im Wissenschaftsjournalismus, der dem KI-Thema besonders nahesteht, keine besorgte Debatte über die Auswirkungen auf den eigenen Berufsstand und keine Gegenstrategien. Eine klassische Betriebsblindheit – wie in anderen Berufsfeldern auch, die von KI überrollt werden.
(6) Für die geopolitischen Veränderungen der Gegenwart, vom Aufstieg neuer Wirtschaftsmächte bis zu kriegerischen Auseinandersetzungen, bilden Informationen eine zentrale Grundlage – ob digital oder analog. Informationen werden im "Informationskrieg" gezielt als Waffe eingesetzt. Dieses Manipulationspotenzial tangiert den Journalismus und seinen Wahrheitsauftrag insgesamt. Der Wissenschaftsjournalismus müsste diese Mechanismen verstärkt thematisieren, was er bisher versäumt oder verweigert.
(7) Mit der Politik ist der Wissenschaftsjournalismus nie in ein brauchbares Verhältnis gekommen. Wenn der Bundestag über Wissenschaft diskutiert, quittiert die Fachpresse dies mit Ignoranz. (Eine Sonderrolle allerdings, das sollte auch erwähnt werden, nehmen die beiden Medien-Innovationen "Research Table" und dieser Blog von Jan-Martin Wiarda wahr.)
Die Pointe bei dieser Fernbeziehung: Der Wissenschaftsjournalismus würde die Politik gerne für seine Zwecke einspannen und bastelt seit mehreren Legislaturperioden an institutionellen Lösungen. Auch im derzeit gültigen Koalitionsvertrag der Merz-Regierung findet sich auf Seite 76 der Satz: "Wir gründen eine unabhängige Stiftung für Wissenschaftskommunikation und -journalismus". Was dabei herauskommen soll, weiß zurzeit niemand.
Auf der praktischen Ebene ist die Politik eher dazu geneigt, die Arbeit der Wissenschaftsjournalisten zu erschweren, statt sie zu erleichtern. Aktuelles Beispiel ist die Aussperrung der Öffentlichkeit aus den Sitzungen des Forschungsausschusses im Bundestag. Zu Ampel-Zeiten war diese Transparenz ein großer Gewinn für die Berichterstattung über Abläufe in der Wissenschaftspolitik. Legendär die Vernehmungen der BMBF-Ministerin zur "Fördermittelaffäre". Dieses Fenster hat der Ausschuss wieder geschlossen. Doch wenn er nun ausgerechnet beim Aufbau einer Journalismus-Stiftung helfen soll – wird da nicht der Bock zum Gärtner gemacht?

Manfred Ronzheimer ist in Berlin als freier Wissenschaftsjournalist tätig, unter anderem für die Tageszeitung taz und den Tagesspiegel. Foto: EIT.
Kommentare
#2 - Wissenschaftsjournalismus - M. Ronzheimer
Ich habe etwas gewartet und bin enttäuscht, dass wir als Wissenschaftsmedien-Community nicht auf die ehrliche und gute Vorlage von Manfred Ronzheimer - und implizit auch durch die Veröffentlichung dieses Gastbeitrages durch Martin Wiarda auf seine Agenda - eingestiegen sind.
Ja, wir müssen uns ehrliche Gedanken machen über die Rolle, die Möglichkeiten und die Zukunft des Wissenschaftsjounalismus. Dieser gerät an den Rand der hoch entwickelten und sehr auskömmlich finanzierten PR-Instrumente in Wissenschaft und Forschung. Ich sage das aus Erfahrung: Ich arbeite mit Lemmens Medien „nicht“ frei journalistisch, ich bin Teil des PR-Systems. Ich weiß aber ebenso, wie wichtig die einordnende Aufgabe des „freien“ und ausreichend „finanzierten“ Wissenschaftsjournalismus für die Profilbildung der einschlägigen Einrichtungen in Lehre, Forschung und Transfer ist. Und wenn ich sehe, wie wenig Aufsehen und echtes Gegensteuern das „Aus der DUZ“ (Deutsche Universitätszeitung) nach Jahrzehnten journalistischer Begleitung unter Universitäten, Fachhochschulen und Einrichtungen der außerhochschulischen Landschaft erregt hat, dann ist das ein sehr, sehr negatives Zeichen. Nicht zuletzt muss Martin Wiarda Monat für Monat um seine Zuwendungen für seinen exzellenten Blog werben, ja ringen. Das ist beschämend. Vielleicht möchte das Wissenschafts-System gar keine journalistische Begleitung? Wen diese Frage stört, sollte die Debatte um dessen Zukunft führen. Dazu ist jetzt die Zeit.








Neuen Kommentar hinzufügen