Hochschulen brauchen wirkmächtige Chefs. Doch echte Macht erwächst ihnen nur, wenn gleichzeitig neue Formen der Mitbestimmung für alle etabliert werden. Eine Replik auf George Turner.
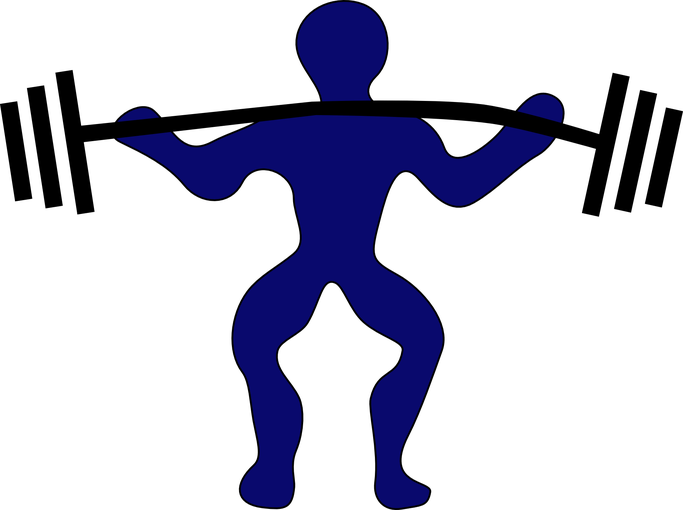
EINES MÖCHTE ICH vorab versichern. Ich bin keiner, der sich Universitäten zurückwünscht, wie sie in den 70er und 80er Jahren organisiert gewesen sein sollen. Teilweise unregierbar, gefangen in der Selbstblockade zwischen den Statusgruppen, schwachen Rektoren und Dekanen, die keine Lust zum Führen hatten. Keine Ahnung, ob und wann Hochschulen wirklich so eine miese Governance hatten, aber das ist das Bild, das viele heute von ihnen zeichnen.
Zum Beispiel mein Tagesspiegel-Mitkolumnist George Turner. Bereits im Februar warnte er: "Mitbestimmung nicht übertreiben", und vergangene Woche befand er sogar: "Mitbestimmung lenkt nur ab.“ Dass Berlin eine Arbeitsgruppe "Demokratische Hochschule" eingerichtet habe, zeige, "wie weit man sich von der Kernfrage entfernt". Die da laute: "Wie Einrichtungen zu organisieren sind, deren Aufgabe Forschung und Lehre ist".
Nun hat George Turner eindeutig den Erfahrungsvorteil. Ich kann dem vor allem meinen womöglich naiven Glauben entgegensetzen, dass nur eine Hochschule, die mit sich und allen ihren Mitgliedern im Reinen ist, eine starke, eine handlungsfähige Hochschule sein kann.
Eines weiß allerdings genau: In den vergangenen 20 Jahren war das vielerorts nicht der Fall. Die Macht der Rektoren und Präsidenten mag gestärkt worden sein, doch es ist eine Macht auf dem Papier, solange sie nicht Akzeptanz bei denjenigen findet, die geführt werden sollen. An einigen Hochschulen gelangten Persönlichkeiten an die Spitze, die trotz ihrer Machfülle (oder weil sie sie geschickt ausgenutzt haben) diese Akzeptanz gefunden haben. An anderen Hochschulen entstanden neue Formen des Gegeneinander-Arbeitens und der Verweigerung.
Was ich damit sagen will: Die Frage, wie Hochschulen idealerweise organisiert sein sollten, um ihre Kernaufgaben möglichst effektiv erledigen zu können, ist – anders als Turner – nahelegt – eben genau nicht zu trennen von der Frage der Mitbestimmung. Auch der Wissenschaftsrat, dessen neulich veröffentlichte "Empfehlungen zur Hochschulgovernance" Turner zitiert, positioniert sich ganz bewusst nicht für oder gegen ein bestimmtes Governance-Modell. Die plakative Zustandsbeschreibung des Wissenschaftsrates lautet schlicht: "Es knirscht an vielen Stellen."
Ja, es knirscht, weil alle Reformen es bislang nur in Ansätzen und ganz sicher nicht flächendeckend vermocht haben, die notwendige Stärkung der Hochschulleitungen mit dem besonderen Wesen und dem Selbstverständnis akademischer Institutionen zu versöhnen. Das gelang, siehe oben, nur einigen besonderen Führungspersönlichkeiten. Systematik geht anders.
Gegen eine Arbeitsgruppe "Demokratische Hochschule" ist also nichts zu sagen. Solange sie den Blick nach vorn richtet und nicht nach hinten. Solange sie nicht nur der alten Gruppenuniversität neues Leben einhaucht, sondern fragt: Wie kann moderne Mitbestimmung im 21. Jahrhundert aussehen? Und welches Modell ist passt zu welcher Hochschule? Nur wenn diese Fragen angemessen beantwortet werden, können die starken Hochschulleitungen, die Turner zu Recht fordert, wirklich stark sein.
Dieser Kommentar erschien heute zuerst in meiner Kolumne "Wiarda will's wissen" im Tagesspiegel.
Kommentar schreiben
Daniel Siemens (Montag, 03 Dezember 2018 14:10)
Sehr geehrter Herr Wiarda, danke für Ihre differenzierte Stellungnahme, die ich voll unterstützen würde. Ein vergleichender Blick nach Großbritannien, wo ich inzwischen tätig bin, lohnt in diesem Zusammenhang besonders. Hier kann man besichtigen, wie die Motivation und damit verbunden auch die Leistung sinkt, wenn akademische Mitbestimmung allenfalls auf dem Papier steht. Mit herzlichen Grüßen, Ihr
Daniel Siemens
Thomas Stelzer-Rothe (Montag, 03 Dezember 2018 14:39)
Da ich seit vielen Jahren als Mentor und Coach Professorinnen und Professoren berate und selbst Hochschullehrer bin, kann ich die kritischen Aussagen des Artikels nur bestätigen. Zusammen mit den empirischen Untersuchungen, die ich in den letzten 10 Jahren an den Fachhochschulen in NRW durchgeführt habe, ergibt sich zumindest an einigen Hochschulen ein düsteres Bild. Eine Lösung ist dringend angeraten, weil die bisherigen Versuche über formell stärkere Hochschulleitungen ins Leere laufen oder massive Konflikte hervorrufen, wenn die Akzeptanz bei den Betroffenen fehlt. Das ist durchaus in NRW beobachtbar.
Im Kern steht nach wie vor und immer wieder die mit Verantwortung wahrgenommene und auf das Gemeinwohl ausgerichte Freiheit der einzelnen Akteure.
Kreative Lösungen sind gefragt und Beteiligte, die einen Ausgleich der berechtigten Interessen herstellen wollen und können, weil sie u.a. einfühlsame Kommunikation, angemessene Partizipation und authentische Kooperation auf hohem Niveau beherrschen.
Da ist viel zu tun - auf allen Seiten!
Michael Hoelscher (Freitag, 07 Dezember 2018 09:48)
Tatsächlich '"knirscht es an vielen Stellen". Und es gibt genügend Dinge, die sich (mehr oder weniger leicht) in der Governance verbessern lassen.
Aber das "Knirschen" werden wir in den Hochschulen als "spezifischen" Organisationen (C. Musselin) nicht weg bekommen, und sollten wir meiner Meinung nach auch nicht. Wichtig ist zu gucken, wo sich dadurch Reibungsverluste ergeben, und wo dadurch produktive Wärme entsteht.
Das Ziel guten Wissenschaftsmanagements und Governance muss es sein, möglichst große Freiräume für Motivation und Kreativität zu schaffen. Die Hochschulen sind so komplex, dass sie an manchen Stellen etwas mehr Führung / Strategie durchaus vertragen, gleichzeitig aber an anderen noch mehr Mitbestimmung benötigen.
Dieter Timmermann, Universität Bielefeld (Freitag, 07 Dezember 2018 12:05)
Mitbestimmung ist nicht gleich Mitbestimmung, es kommt darauf an, wie eine Hochschulleitung die von ihr geplanten oder auch schon getroffenen Entscheidungen vorbereitet und kommuniziert. Es ist m. E. nicht so entscheidend, dass alle Entscheidungsbetroffenen (Lehrende, Mitarbeitende, Studierende) basisdemokratisch an den Entscheidungen mitwirken, sondern dass zunächst kommuniziert wird, was entschieden bzw. was verändert werden soll. Hier geht es also um die Frage der Handlungsziele. Zweitens mus kommuniziert werden, wie das Ziel/ die Ziele erreicht werden soll(en). Drittens ist zu klären, wer (welche Personen aus welchen Statusgruppen) an der Erarbeitung und Konkretisierung der Ziele , der Handlungsalternativen und des letztlich erarbeiteten Vorschlags beteiligt werden soll. Hier bieten sich im Wesentlichen vor dem Hintergrund, dass es ja qua Hochschulgesetz und Grundordnung Kommissionen gibt, die für bestimmte Handlungsfelder für den Senat und die Hochschulleitung beratend zuständig sind (z. B. Lehr- oder Forschungs- oder Finanzkommission) zwei Alternativen an: Entweder gibt die Hochschulleitung den Projekt- oder Entwicklungsauftrag direkt an die entsprechende Kommission oder sie bildet eine Projektgruppe, die den Auftrag erhält, eine Empfehlung oder eine Problemlösung zu entwickeln, die dann in der zuständigen Kommission diskutiert, verändert oder unverändert verabschiedet und der Hochschulleitung vorgelegt wird. Meine Erfahrung über 13 Jahre Mitwirkung in einer Hochschulleitung ist folgende: Wenn immer es darum ging, ein Organisationsentwicklungsprojekt zu gestalten (z. B. Entwicklung eines Internationalisierungskonzepts), zeigte sich in den qua Grundordnung zuständigen Kommissionen kaum ein Mitglied bereit, diese Arbeit zu übernehmen, in aller Regel wurde der Auftrag von dort an das zuständige Prorektorat samt Referent/in verwiesen. Das führte genau zu dem TOP-Down Problem ("Alles kommt von oben"). Wir haben dann einen zweiten Weg eingeschlagen, indem wir Projektgruppen gebildet haben, die keinen Proporz verlangten und die wir als Rektorat mit Personen besetzt haben, die in ihren Statusgruppen Anerkennung hatten, die in der Regel nicht bereit waren, sich in den ständigen Kommissionen zu engagieren, wohl aber gerne in diesen auf überschaubare Dauern (meist ein halbes Jahr) befristeten Projektgruppen mitarbeiteten. Das hatte zwei große Vorteile: Die Arbeitsergebnisse waren sehr gut und sie wurden durchweg von den Statusgruppen mitgetragen und von den Kommissionen akzeptiert, schließlich von der Hochschulleitung und vom Senat verabschiedet. Klagen, das sei über die Köpfe der Betroffenen hinweg entwickelt und entschieden worden, haben wir in diesen Fällen nicht gehört.