Bayerns Staatsregierung will an der neuen TU Nürnberg Englisch als Hauptsprache etablieren. Eine weniger wohlfeile Vorstellung von "Internationalität" würde zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen. Ein Gastbeitrag von Herrmann H. Dieter.
DIE KOMMENDE TU NÜRNBERG soll anscheinend Prototyp einer "internationalen Universität" im deutschen Sprachraum werden – und zugleich Inbegriff einer unternehmerischen, von allem verwaltungs- und wissenschaftshistorischen Ballast befreiten Hochschule. Die Staatsregierung setzt deshalb im Gesetz zur Errichtung der TUN (TU Nürnberg-Gesetz – TNG), das am 09. Dezember auch im Landtag beschlossen wurde, bedenkenlos auf die lingua franca des internationalen Erkenntnishandels und -verhandelns, nämlich Englisch. Sie tut dies trotz aller damit zusammenhängenden verfassungsrechtlichen, hochschulpolitischen und bildungsdidaktischen Probleme und ignoriert zugleich eine Vielzahl offener Fragen.
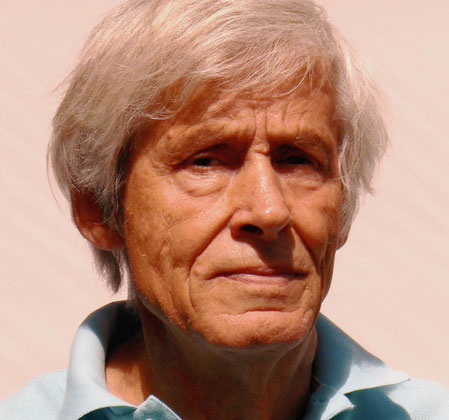
Hermann H. Dieter ist Biochemiker und Toxikologe. Er war 2007 Mitgründer und ist seitdem stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Deutsch als Wissenschaftssprache.
Foto: privat.
So heißt es in Artikel 4, Absatz 3 des TNG zur Lehrsprache der TUN lapidar: "An der Universität werden überwiegend englischsprachige Studiengänge angeboten", und zwar ohne jede sprachenpolitische Präzisierung oder Einschränkung.
Das Gesetz steht damit in offenem Widerspruch zu den sprachenpolitischen Empfehlungen etwa von Hochschulrektorenkonferenz sowie Wissenschaftsrat. Diese verlangen
beispielsweise ausdrücklich, zwischen Unterrichts-, Prüfungs-, Fach- und Verkehrssprache zu unterscheiden. Mit dem TNG ignorierte der bayerische Landtag sogar seine eigenen, am 17. Juni 2020
erhobenen sprachenpolitischen Forderungen an die Staatsregierung, zu prüfen
- "wie bei der bevorstehenden Reform des Hochschulgesetzes im Rahmen der vorhandenen Stellen und Mittel sichergestellt werden kann, dass auch die Deutschkenntnisse der ausländischen
Studierenden und der einheimischen Studierenden mit geringen Deutschkenntnissen bestmöglich gefördert werden,
- ob und wie erreicht werden kann, dass die Studierenden parallel zum Studium entsprechende Kenntnisse nachholen, um bis zum Studienabschluss ein Sprachniveau zu erreichen, das ihnen nach
Abschluss des Studiums die Mitarbeit auch in Unternehmen ermöglicht, in denen Deutsch als Umgangssprache gesprochen wird,
- ob die Motivation der Studierenden dadurch gefördert werden könnte, dass durch erfolgreiches Ablegen von Sprachprüfungen auch ECTS-Punkte erworben werden,
- ob und wie diese Verpflichtung der Hochschulen beim nächsten Durchgang der Zielvereinbarungen verankert werden könnte,
- wie Mehrsprachigkeit in den unterschiedlichen Fächern jeweils gefördert werden kann."
Heilen wenigstens die am 20. Oktober veröffentlichten, in der Wissenschaftsszene umstrittenen Eckpunkte der bayerischen Staatsregierung zur Novellierung des Hochschulgesetzes, das für alle
Hochschulen und damit auch für die TUN gilt, dieses Manko? Immerhin klingen sie zu der Frage nach anderen Lehrsprachen als der deutschen differenzierter als das Errichtungsgesetz für die TU
Nürnberg. Denn sie koppeln
- die Erwartung, rein "fremdsprachige" (also wohl insbesondere englischsprachige) Studiengänge würden dafür sorgen, die Attraktivität des bayerischen Hochschulstandorts und seine Sichtbarkeit
im internationalen Wettbewerb weiter zu steigern, und die damit verbundene
- Hoffnung auf weniger "Wettbewerbsnachteile der bayerischen Hochschulen bei ihren Bemühungen um die weltweit besten Köpfe" an die
- Vermittlung von "Deutschkenntnissen als Hochschulaufgabe".
Auch die Erwartung an die für ein fremdsprachiges Studium nötigen Sprachenkenntnisse konkretisieren die Eckpunkte. Sie stellen den Hochschulen die Erlaubnis in Aussicht, "die erforderlichen Sprachkenntnisse als Zugangsvoraussetzung für grundständige Studiengänge verlangen (zu) dürfen". Aber: "Das verlangte Niveau darf dabei B1+ / B2 nicht übersteigen."
Wie bitte? Die Hochschulen "dürfen", müssen sich aber nicht um die sprachbasierte Studierfähigkeit ihrer Studierwilligen kümmern? Und wenn sie es doch tun, dann dürfen sie dies nur bis bestenfalls Niveau B2, das einer (alltagstauglichen) "selbstständigen" Fremdsprachverwendung entspricht, tun – nicht aber bis zu einem (fachlich!) "kompetenten" Niveau wie C1?
Eine staatlich verordnete Amputation
der Qualität akademischer Lehre
Dass noch dazu das Niveau zu vermittelnder Deutschkenntnisse überhaupt nicht präzisiert wird, würden die Eckpunkte unverändert Gesetz, käme einer staatlich verordneten Amputation der Qualität akademischer Lehre gleich. Beschönigt würde sie als Ausdruck der den Hochschulen in den Gesetzes-Eckpunkten versprochenen "vollen Eigenverantwortung", hier zur Ausgestaltung ihres Gesamtlehrdeputats.
Was wäre die Folge des erwartbar "unternehmerischen" Konkurrenzkampfs zwischen den Hochschulen um ein scheinbar "Exzellenz"-förderndes Maximum internationaler Studierwilliger? Die systematische Senkung des sprachlichen Anforderungsniveaus auf ein Minimum! Antreiber wäre, wie immer wieder durchsickert, bald auch die Angst der Hochschulen vor einer gegenseitigen "Kannibalisierung". Gegen jede hochschul- und sprachenpolitische Vernunft sehen sich namentlich einige Fachhochschulen schon gehalten, landessprachliche Lehrangebote zugunsten englischsprachiger, die von Studierwilligen sogar ohne jede Deutschkenntnisse und doch auf Kosten der Steuerzahler belegt werden dürfen, ganz abzuschaffen. Schon seit September 2019 sehen sich alle Hochschulen von Staatsminister Bernd Sibler genau dazu sogar ermutigt.
Gerade wissenschaftspolitisch einflussreiche Köpfe wie Wolfgang Herrmann, der spiritus rector der TUN, scheren sich nach wie vor nicht um die Ignoranz, mit der Politik und Hochschulen die eingangs genannten sprachenpolitischen Empfehlungen übergehen. Wohlfeile Schlagworte wie "Exzellenz" und "Internationalität" machen sie blind für den Mehrwert wissenschaftlich und kulturell produktiver Konzepte von fachspezifischer sprachlicher Vielfalt. Eine weniger wohlfeile Vorstellung von "Internationalität", die mehr will als es diese lediglich regionalpolitisch motivierten Schlagworte je behaupten könnten, führt jedenfalls auf genau solche Konzepte. Und im außerbayerischen Ausland sind sie am Beispiel des Sprachenkonzeptes der Technischen Universität Braunschweig auch schon dabei, erlebbar zu werden.
Kommentar schreiben
Edith Riedel (Freitag, 08 Januar 2021 11:33)
Die "Mehrsprachigkeit" an Hochschulen ist ebenso ein leeres Schlagort wie die "Internationalität" oder auch die "Exzellenz". Diese leeren Schlagworte mit gelebten Inhalten zu füllen ist eine immense Herausforderung. Oft sind die Konzepte politisch gewünscht, aber nicht von ihrer Umsetzbarkeit her gedacht. Ich habe bis jetzt noch keine Hochschule erlebt, an der eine wirkliche Mehrsprachigkeit erfolgreich umgesetzt und gelebt worden wäre, zum Mehrwert für ALLE Beteiligten (Studierende und Hochschullehrer*innen) und nicht nur als schönes Projekt eines eigens dafür gegründeten Arbeitskreises. Dafür erlebe ich immer wieder Vorbehalte und eine geradezu hasserfüllte Ablehnung gegen die Linga Franca Englisch, vor Allem in den Geisteswissenschaften aber auch ganz stark in den Hochschulverwaltungen, die so tun, als müssten alle Studierenden, Promovierenden und Hochschullehrer*innen perfekt des Deutschen mächtig sein. Das Deutsche als Wissenschaftssprache hat seine Zeit gehabt. Wie glanzvoll sie auch immer gewesen sein mag - in einer internationalisierten Forschungs- und Bildungswelt machen Einzelsprachen als Vermittlungsmedium für Inhalte nur noch sehr bedingt einen Sinn. In der Forschung sind sie so oder so schon obsolet.
tmg (Freitag, 08 Januar 2021 18:14)
@Edith Riedel: Sie forschen sicher selbst und wissen deshalb so genau Bescheid, was in der Forschung obsolet ist, gell?
Edith Riedel (Samstag, 09 Januar 2021 14:43)
Liebe*r tmg,
hoppla, da habe ich ganz offensichtlich einen etwas wunden Punkt getroffen. Geforscht habe ich lange selbst, aber das tut hier ja nichts zur Sache. Nationalsprachen als Medium zur Verbreitung von Forschung halte ich in unserer international vernetzten Wissenschaftswelt in der Tat für obsolet. Was nützt die schönste Forschung, wenn sie nur einem Bruchteil der wissenschaftlichen Community zugänglich ist?
Mit friedlichen Grüßen
Edith Riedel
Th. Klein (Montag, 11 Januar 2021 12:01)
Ach, ich dachte wir kämen langsam darüber hinweg. Inzwischen gibt es sehr gute Übersetzungsprogramme, so dass doch zumindest in den gängigen (Wissenschafts)Sprachen man auch Artikel in anderen Sprachen wahrnehmen kann und diese somit zugänglich ist.
Franz-Kanns (Dienstag, 12 Januar 2021 19:42)
Nett, nett, wie Frau Riedel mit quasi klischeehaften Worten die Tunnelblick-Weltsicht der heutigen Wissenschafts-„Community“ wiedergibt. Eben ganz so die nichts hinterfragende Stromlinienförmigkeit, die es heute tatsächlich braucht für eine Forscherkarriere.
Mit originärem Forscher- und Erkenntnisdrang hat das allerdings nichts zu tun, da würden sich solche bornierten Basta-Worte („hat seine Zeit gehabt“) von selbst verbieten. Wie viel anders etwa Wilhelm von Humboldt in einem Brief von 1790:
„Ich lerne jetzt Hebräisch bei Spaldings jüngstem Sohn ... Die Sprache interessiert mich bloß um ihrer selbst willen. Sie weicht so erstaunlich von allen andern ab, und sie trägt noch so viele Spuren von der ersten rohen Ideenentwickelung. Das ist mir überhaupt beim Sprachstudium fast allein wichtig, daß man die vielfältigen Arten kennen lernt, in welcher die Ideen ausgedrückt werden können. Der eigne Ausdruck in der Sprache, in der man nun selbst schreibt oder spricht, erhält nicht bloß dadurch mehr Geschmeidigkeit und eine mannigfaltigere Bildung, sondern die Klarheit der Ideen selbst gewinnt, je mehrere und verschiedenere Formen man davon lernt.“
Tja, eine solche Neugier an sich stört natürlich auch eher bei einer heutigen Wissenschaft, bei der die Zahl der Publikationen und der „Impact factor“ im Mittelpunkt stehen, Maßstäbe, die eigentlich jeden unabhängigen Geist beleidigen. Vielleicht passiert ja auch genau deshalb seit Jahrzehnten nichts Neues in der Grundlagenwissenschaft? Die Gravitationswellen? Hatte Einstein schon 1916 vorausgesagt. Quantenmechanik? Funktioniert, aber keiner weiß besser als vor 100 Jahren, wieso. „Große Vereinheitlichung“? Driftet nach mehreren 10.000 Publikationen zu Strings und Multiversen schon länger in die Metaphysik ab. Vorhersagen daraus: Null.
Die Grundlagenphysik steckt fest: womöglich, weil es dort längst nur noch Forscher gibt, die Frau Riedel sofort zustimmen würden? Und die sich über ihr wichtigstes Erkenntnisinstrument, die Sprache, nicht einmal mehr Gedanken machen?
Nichtsdestotrotz ebenfalls friedliche Grüße.
Karl-J. Dittrich (Mittwoch, 13 Januar 2021 02:06)
Es ist deutlich an Frau Riedels Ausführungen zu sehen, wie stark die Präsuppositionsbestände hinsichtlich des Englischen in der Wissenschaft sind. Es wird davon ausgegangen, dass Wissenschaft in einer Sprache abbildbar ist, eine Vorstellung, die schon unhaltbar ist, wenn man sich die Ausdrücke science und Wissenschaft anschaut - beide benennen unterschiedliche Konzepte; im Englischen nur die Naturwissenschaft (was dazu führt, dass im angelsächsischen Raum über die Wissenschaftlichkeit der Geisteswissenschaften gestritten wird), im Deutschen wird dagegen durch den Ausdruck Wissenschaft ein Dachkonzept geschaffen, das sich in die verschiedenen bekannten Einzelwissenschaften untergliedert, eine Systematik sozusagen kommuniziert wird. Man sieht also, dass schon bei wissenschaftstheoretischen Fragestellungen die Sprachen stark differenzieren. Ich denke nicht, dass man sich solcher Ressourcen für Erkenntnisfortschritt berauben will bzw. eine Sprache priviligieren will, deren Sprachgemeimschaft es nicht einmal zu einem übergeordneten Wissenschaftskonzept geschafft hat. Das führt zum nächsten Problem: Englisch ist keine neutrale Sprache. Das kann man nicht mehr als genug betonen. Es ist die Sprache der politisch, wirtschaftlich und wissenschaftlich dominantesten Gesellschaften der Welt. Diese Sprache hier in Deutschland oder in anderen nicht-englischsprachigen Ländern zu institutionalisieren, wäre erkenntnisfeindlich und neokolonialistisch. Das letzte ist gerade ein Punkt, der vielen nicht auffallen wird, der aber von ungeheurer Tragweite ist. Wenn in einer gewissen Domäne der Gesellschaft nur noch eine fremde Sprache gesprochen wird, werden auch automatisch diejenigen Vorstellungen derjenigen Gesellschaften mit importiert, die diese Sprachen unterhalten, in dem Fall, die Englischsprachigen. Ich glaube nicht, dass es im Sinne einer ergebnisoffenen Wissenschaft und einer demokratischen Gesellschaft ist, sich sprachlich und damit auch gesellschaftlich und wissenschaftlich selbst zu kolonisieren. Hier geht es auch um Aspekte wie Teilhabe und Zugang aller Mitglieder der Gesellschaft zu Wissenschaft. Solche Möglichkeiten beschneidet man, indem man diese Bereiche in eine fremde Sprache überführt. Weiterhin weisen schon etliche Untersuchungen daraufhin, dass die Vermittlung von wissenschaftlichen Wissen in einer fremdem Sprache zu Verständniaproblemen seitens der Studierenden führt. Ich glaube, man will in Bayern das unreflektierte Internationalitätskonzept über die wissenschaftliche Sozialisation der Studierenden stellen...
Ganz nebenbei bemerkt, lohnt ein Blick in andere Länder - in Japan wird beispielsweise nicht einfach - zumal ohne Not, wie in Deutschland - die eigene Wissenschaftssprache über Bord geworfen. Sie wird gefördert, verbreitet, die meisten ausländischen Studierenden (von denen es, der Europäer mag überrascht sein, gar nicht wenige gibt) studieren in jener, es wird darin publiziert, es werden Nobelpreise gewonnen. Der japanischen Gesellschaft und Wissenschaft scheint es nicht zu schaden, die eigene Sprache zu nutzen. Der Irrtum, Englisch sei international und gehöre selbst in den internen Wissenschaftsbetrieb des eigenen Landes, ist keinesfalls eine weltumspannende, einheitliche Ideologie, vielmehr hat man sich da in Europa zu sehr in etwas verannt. Es bedarf hier Aufklärung und eines Kurswechsels. Wir sollten uns in Europa, der Wissenschaft willen alle Ressourcen der Erkenntnisfindung aufrecht erhalten, d.h. auch alle europäischen Wissenschaftssprachen, ansonsten wird es um das unabhängige Unternehmen Wissenschaft in Europa schlecht bestellt sein. Ich möchte hier einen sehr reflektiert denkenden Menschen zitieren: "Einen Königsweg zur Innovation gibt es nicht. Eine ernstzunehmende Sprachpolitik hinsichtlich der europäischen Wissenschaftssprachen hat daher dem Ressourcencharakter der ausgebauten Wissenschaftssprachen für die wissenschaftliche Innovation und deren Transfer Rechnung zu tragen. " (Winfried Thielmamn, Deutsche und Englische Wissenschaftssprache im Vergleich).
McFischer (Mittwoch, 13 Januar 2021 10:34)
Sehr schöne Beiträge hier... aber ich muss die Lanze für Frau Riedel brechen. Denn: Die ganzen Argumente über Englisch als gefährlich dominante Sprache oder das Zitieren von Humboldt ist nett... aber sagen Sie das einmal einem Forscher in der Medizin oder jemanden mit einem ECR-Starting Grant... in vielen Bereichen ist (deutsche) Forschung mittlerweile unabdingbar international. Da bringt es nix, wenn sie ihren Kolleg*innen in Stockholm, Porto und Ann Arbor Vorträge halten, wie wichtig doch Deutsch als Wissenschaftsprache ist.
Karl-J. Dittrich (Mittwoch, 13 Januar 2021 13:08)
McFischer, schön, dass Sie die Beiträge gut heißen, nur ist es so, dass allein schon die unhinterfragte Setzung des Englischen als internationale Wissenschaftssprache das Problem ist. Dieses Nicht-Hinterfragen allein ist schon unwissenschaftlich, weil es suggeriert, dass Sprache etwas ist, was nicht von Belang für Wissenschaft ist. Nun ist es aber so, dass Wissenschaft schon seit der Antike mit Sprache untrennbar verbunden ist; Wissenschaft ist zunächst ein sprachliches Geschäft. Seit der Neuzeit, in die der Beginn der modernen Wissenschaft fällt, ist diese mehrsprachig. Das brachte das neue Konzept von Wissenschaft mit sich, das die Wirklichkeit zum Gegenstand hat. Und wenn zwei in die Wirklichkeit sehen, sehen sie nicht dasselbe und das hat vor allem sprachliche Gründe. Wenn man Wissenschaft auf nur eine Sprache beschränkt, beschränkt man Erkenntnisfindungsmöglichkeiten auch nur auf eine. Das ist nicht im Interesse der Wissenschaft. Und als Randnotiz: Selbst in den Naturwissenschaften waren im 20. Jahrhundert Kongresse und Publikationen mehrsprachig - dies war kein Hemmnis, sondern stark innovationsfördernd, wie die damaligen Fortschritte eindrucksvoll zeigen. Zugleich war es eine demokratische Praxis. Und vielleicht ein weiterer wichtiger Punkt: Es ist ja nicht so, als wäre das Englische in der Wissenschaft, das von Nicht-Muttersprachlern verwendet wird, ein ausgebautes. Es ist ein lingua-franca-Englisch, also ein stark reduziertes Englisch. Und so etwas ist in der Wissenschaft ausgeschlossen. Man schaue sich nur einmal sie sprachliche Virtuosität an, mit der Watson und Crick ihre Entdeckung des genetischen Kopiermechanismus in die wissenschaftliche Community kommunizierten. Auch erwähnen möchte ich, das die deutsche Textstruktur (damit Argumentationsweise) in wissenschaftlichen Texten im Englischen im Prinzip nicht reproduzierbar ist; man sich also angelsächsischen Mustern anpassen muss, was Wissenschaftsfälschung gleichkommt. Wer dennoch versucht, die deutsche Textstruktur im Englischen zu imitieren, wird im angelsächsischen Raum, wie vielfach schon beobachtet, schlicht ignoriert. Eine Teilhabe deutscher und anderer nicht-anglophoner Wissenschaftler am angelsächsischen Wissenschaftsdiskurs ist nur durch eine Initiation in in diesen möglich. Man kann sich also in der fremden Sprache nicht uneingeschränkt Gehör verschaffen.
Und der wichtigste Punkt überhaupt: Die Grundlagen eines Faches, wie sie im Bachelor erworben werden, hat nichts mit international zu tun. Hier die eigene Sprache (welche vertieftes Verständnis, Teilhabe und Gerechtigkeit verschafft - Konzepte, die einigen Vertretern der Wissenschaft offenbar nichts mehr bedeuten) aus der Lehre zu verdrängen, ist unbegründet und wird schwerwiegende, nicht nur kognitive, sondern auch gesellschaftliche Folgen nach sich ziehen: Integration wird gehemmt, wenn nicht gar verhindert, gesellschaftliche Arbeitsteilung erschwert, der Fachkräftemangel durch sprachliche Probleme nicht bekämpft und man steuert, und das ist nicht als gefährlich genug einzuschätzen, auf postkoloniale Zustände zu, wie man sie heute in den Ländern Afrikas hat, in denen die Eliten eine andere Sprache sprechen als die Gesellschaft. Das wäre dann nah an autokratischen Praktiken und nicht wünschenswert für Demokratien, wie jene in Bayern und anderen demokratischen Ländern Europas. Unerwähnt bleiben sollte vielleicht auch nicht, dass, wenn Bayern den anvisierten Weg einschlagen sollte, auch eine Kritik an autokratischen Ländern wie China immer schwieriger werden wird. Die Beispiele von McFischer greifen ohnehin nicht, da Wissenschaft kein von jeglicher Gesellschaft abgehobenes Unterfangen ist. Es ist der Gesellschaft, die sie trägt, verpflichtet (besonders die Medizin) und kann sich daher nicht komplett sprachlich abkapseln. Meine Ausführungen betreffen auch nicht nur Bayern oder Deutschland, sondern alle Länder. Es sollte alles unternommen werden, die jeweils ausgebauten Wissenschaftssprachen zu erhalten, notwendigerweise in der Lehre, für die freie Erkenntnisfindung auch in der Forschung. Und gerade in der Corina-Krise wird deutlich, wie wichtig Transfer wissenschaftlicher Erkenntnis in die Gesellschaft ist. Und ein Unternehmen, das sich zur Zeit in aller Munde befindet - BioNTech - hat Deutsch nicht komplett aus seiner wissenschaftlichen Arbeit verbannt.
Franz-Kanns (Mittwoch, 13 Januar 2021 16:45)
An McFischer
Wo ein Wille wäre, wäre auch ein Weg, Ihr "unabdingbar international" ist nicht gottgegeben, sondern in der jetzigen Form bereits Folge der von der Politik gesetzten Anreizsysteme, auf die der einzelne Wissenschaftler fast gar keinen Einfluß hat. Würden sich nun z.B. alle deutschen Institutionen, die deutsches Steuergeld an Universitäten, Forschungsprojekte und Forschungsinstitute verteilen, auf ein neues Anreizsystem einigen, das die Pflege und Förderung der deutschen Sprache in der Wissenschaftspraxis angemessen finanziell und konkret würdigt - was glauben Sie, wie schnell sich auch die Alltagspraxis in der Medizin und den Naturwissenschaften wieder ändern würde!
Klaus Diepold (Mittwoch, 13 Januar 2021 16:58)
Vielleicht entspannt es darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um eine Technische Universität handeln soll, und dass es mir nicht angemessen erscheint, die hauptsächlich technischen Studienfächer mit der Aufgabe der Spracherhaltung zu beauftragen. Zudem möchte ich in Zweifel ziehen, dass der Vorschlag die Lehre auf Englisch anzubieten ohne Hinterfragen formuliert worden sei. Woher wissen Sie das denn?
Sie können diesen Vorschlag für die TUN auch als ein Realexperiment betrachten, um zu lernen was durch so eine Maßnahme ausgelöst bzw. erreicht werden kann. Ist es nicht auch wissenschaftlich, Hypothesen aufzustellen und
anhand von Experimenten zu falsifizieren? Unter diesem Gesichtspunkt finde ich es nicht gerechtfertigt, den Vorschlagenden Ignoranz vorzuwerfen ohne sich selbst dem Vorwurf der Arroganz auszusetzen. Es bleiben mehr als genug Alternativen für Wissenschaftler und Studierende übrig, um konventionell in deutscher Sprache zu studieren und zu forschen.
Ich bin interessiert mehr daran zu sehen, wie sich diese Universität entwickelt, und was wir dabei lernen können statt von vornherein entsprechende Initiativen zu blockieren. Ist das nicht der Geist der Innovation? Etwas auszuprobieren?
hahadi (Donnerstag, 14 Januar 2021 13:50)
Es ist mir unverständlich, warum wissenschaftlich arbeitende Internationalisten angesichts von Argumenten zugunsten mehrsprachigen (auch rezeptiv mehrsprachigen und digital unterstützten) Erkennens, Diskutierens und Kommunizierens
1) immer so rasch in argumentative Schockstarre verfallen,
2) sich mit den immer gleichen, also längst mehr neuen oder originellen Argumenten panzern und
3) den "Illusionisten" der Gegenseite unterstellen, sie kennten diese Argumente nicht längst zur Genüge.
Wer je zumindest einen eigenen muttersprachlichen wissenschaftlichen Text ins Englische übersetzt hat (und solche Wissenschaftler, auch Naturwissenschaftler soll durchaus noch geben) erfährt in der eigenen Sprache und Denke, wie sehr er und sie damit auch sein "Wissenschaftler-Englisch" immer weiter hin zu einer wissenschaftlich ausgebauten Sprache erweitern kann und sich seine Gedanken dabei Schritt um Schritt so schärfen, dass er rückwirkend auch im eigenen muttersprachlichen Text Unschärfen von Ausdruck und Argument erkennt, die er in der unbesetzten Erstfassung seines Textes eigentlich für ausgemerzt hielt.
Es gibt keine bessere Schule des scharfen und kreativen Denkens als die des mehrsprachigen Denkens, Diskutierens und Kommunizieren. Ist es nur Bequemlichkeit, warum die Internationalisten das nicht sehen wollen, ist es mangelnde Erfahrung beim mehrsprachigen Umgang mit eigenen Texten oder schlicht Defätismus der Art "der Zug ist sowieso lägst abgefahren"! Nur wohin wäre er denn dann längst abgefahren? Heißt der nächste Bahnhof TUN - also eine womöglich auf Druck der Fa. Siemens zustandekommen, rein privatwirtschaftlich arbeitende, interessierte und stark Drittmittel-finanzierte unternehmerische und doch staatliche Universität, die dem Drittmittelgeber viel eigene Investitionen und lästige Gremien in einer in Franken bereits reichlich bestückten und leistungsfähigen Universitätslandschaft erspart, die Mitsprache in der Landessprache einfordern könnten?
Oliver Locker-Grütjen (Donnerstag, 14 Januar 2021 20:45)
Zustimmung und Ergänzung.
Als Präsident der Hochschule Rhein-Waal (HSRW), möchte ich ergänzend anmerken, dass „capacity building“ und internationale Exzellenz weitaus umfassender betrachtet werden müssen.
Die HSRW ist zur Gründung im Jahr 2009 als internationale Hochschule angelegt worden, mit dem fokussierten Ansatz, internationale Studierende zu attrahieren. Die Studiengänge und -fächer werden zu 75% in englischer Sprache abgehalten, der Anteil ausländischer Studierender beträgt stets über 50%. Platz 1 im DAAD-Ranking für Internationalität ist der HSRW stets sicher, mit weitem Abstand auf die zweitplatzierte Hochschule. Reicht dies als Parameter für Internationalität?
Ist das Ziel von Internationalität die Quantität an englischsprachigen Studiengängen und ausländischen Studierenden? Sicherlich nicht!
Gehören zur Internationalität (und Heterogenität) nicht auch Kulturvermittlung und landesspezifische Besonderheiten dazu? Sicherlich!
Ich möchte jedoch auch gerne ergänzen, dass es jenseits der Sprachkompetenz der Studierenden in Englisch und Deutsch, auch um Sprachkompetenz der Lehrenden und Forschenden, ja aller Hochschulmitglieder, berücksichtigt werden muss. Auch hier gibt es sichtbare Herausforderungen, z.B. in Gremiensitzungen und Berufungsverfahren, um nur zwei zu benennen. Sprache muss auch als Transporteurin von Inhalten wie auch von Kulturverständnis begriffen werden.
Ich halte es daher für notwendig, dass sich eine international ausgerichtete Hochschule in Deutschland (welche Hochschule ist dies wohl nicht!) einer Mehrsprachigkeit verpflichten sollte und dabei sowohl in ihrer Alltagssprache als auch bei der Vermittlung von Kulturkompetenz Deutsch für alle Akteur*innen in der Hochschule gewährleisten sollte.
Klaus Diepold (Freitag, 15 Januar 2021 12:40)
Lieber Herr Wiarda,
vielleicht wäre es überlegenswert zu den einzelnen Diskussionsbeiträgen für die Leser die Möglichkeit zu schaffen, Zustimmung oder Ablehnung in Form von erhobenen oder gesenkten Daumen auszudrücken? :-)
Jan-Martin Wiarda (Freitag, 15 Januar 2021 13:33)
Lieber Herr Diepold,
ein guter Vorschlag! Ich checke das mal, fürchte aber, das wir mit der Technik eines Providers nicht umsetzbar sein.
Viele Grüße
Ihr J-M Wiarda
Karl-J. Dittrich (Sonntag, 17 Januar 2021 22:21)
Anmerkung zur Aussage von Herrn Locker-Grütjen:
Ich finde es gut, dass Sie die Notwendigkeit von Mehrsprachigkeit herausstellen, allerdings trennen Sie m.E. noch zu stark zwischen Kultur und Wissenschaft. Die Wissenschaft wird von der sie je unterhaltenden Gesellschaft getragen, beruht auf der Alltagssprache dieser Gesellschaft. D.h. Wissenschaft und Gesellschaft tragen sich gegenseitig und stehen in ständiger Wechselwirkung. Schon aus diesem Grund kann Englisch nie Ausweis von Internationalität sein, da es die Sprache nur einiger weniger, dazu noch sehr machtvoller Gesellschaften ist. Wenn man dies nicht beachtet, droht der von mir schon weiter oben erwähnte Neokolonialismus.
Auch nicht vergessen werden sollte, dass es sich bei der Hochschule Rhein-Waal um eine staatliche Hochschule handelt, also eine Verpflichtung gegenüber der eigenen Gesellschaft besteht und diese sicher nicht mit einer Überfülle fremdsprachiger Studiengänge eingelöst werden kann. Zumal sich die Frage in einer Demokratie stellt, ob es überhaupt im Interesse der Bevölkerung war, diese Hochschule mit diesem Profil zu gründen. Wie sollen Absolventen Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen, wenn sie über keine Deutschkenntnisse verfügen? Diese sollten Pflicht in den Curricula sein. Man könnte nun behaupten, es gibt genügend Unternehmen in denen Englisch gesprochen wird, nur ist dies auch wieder ein Aspekt, der hinterfragt werden müsste. Integration ist mit der Ausrichtung der Hochschule Rhein-Waal so allerdings nicht möglich. Eine wahrhaft "internationale" Hochschule müsste wissenschaftliche Mehrsprachigkeit (auch andere Sprachen neben Deutsch und Englisch) ab Masterniveau pflegen, im Bachelor allerdings deutschsprachig sein und somit der Gesellschaft Rechnung tragen (und damit auch gesellschaftliche Spaltung vermeiden und Teilhabe an wissenschaftlichem Wissen in der von der Gesellschaft getragenen Sprache ermöglichen). Nur so lässt sich auch Demokratie wahren. Im allgemeinen ist es ohnehin für Einwanderungsgesellschaften wie Deutschland nicht gut, wenn alle Top-Domänen von einer fremden Sprache besetzt werden. Dies schafft postkoloniale Zustände, wie wir sie heute in Afrika haben und da endet Demokratie. Einwanderungsgesellschaften müssen, in Gegensatz zu den angelsächsischen Ländern, die Herkunftssprachen der Einwanderer fördern (z.b. in den ersten Schuljahren nutzen, wie wir es auch schon mancherorts haben). Dies birgt in einer vernetzten Welt ein großes Potenzial. Um aber nicht zu einem Anhängsel des angelsächsischen Kultur- und Sprachimperialismus zu werden, muss hierzulande die deutsche Sprache, als die alle gesellschaftlichen Bereiche verbindende, in allen Top-Domänen (Verwaltung, Rechtssprechung, Wissenschaft usw. ) fungibel und verbindlich bleiben.
Vielleicht noch ein Kommentar zu den Ausführungen von Herrn Diepold: Selbstverständlich müssen Demokratien für neue Dinge zugänglich sein. Das steht außer Frage. Nur dürfen diese Dinge nicht ohne breite gesellschaftliche Diskussion, und ohne vernünftige Argumente durchgesetzt werden; vor allem wenn es weitreichende Folgen, wie im Falle Bayerns, hätte. Und natürlich ist es nicht so, dass nur die Ingenieurswissenachaften für die deutsche Sprache zuständig sind, allerdings sind diese in zahllosen gesellschaftlichen Bereichen relevant. Sie tragen wie jede Wissenschaft zur Innovationsfähigkeit der Gesellschaft bei. Wenn man nun die deutsche Sprache aus immer mehr Fachgebieten verdrängt, wird dort kein Deutsch mehr gesprochen und irgendwann können diese Dinge auch gesellschaftlich nicht mehr auf Deutsch verhandelt werden, wenn die Anglisierung überhand nimmt. Wie so gesellschaftlicher Diskurs möglich bleibt, ist fraglich. Auch würden ganze Industriezweige und viele Unternehmen in die Anglophonie abwandern. Alle Wissenschaften, alle Hochschulen sind für die deutsche Sprache verantwortlich. Der Verweis auf die Zuständigkeit anderer Hochschulen, also die Möglichkeit an anderen Hochschulen ja noch auf Deutsch studieren zu können, ist nicht sinnvoll.
Zum Schluss möchte ich noch auf etwas aufmerksam machen, was in den Kommentaren bisher noch nicht angesprochen wurde: Wenn eine Sprache, in unserem Falle das Deutsche in Bayern, mittelfristig in den Natur- und Ingenieurswissenschaften selbst aus dem Bachelor verdrängt wird, werden irgendwann die Rufe nach einer englischsprachigen Oberstufe an den Schulem laut werden; zur Vorbereitung auf den schon englischsprachigen Bachelor, eine Situation wie sie bspw. in Indien anzutreffen ist. Damit würde dann das Englische in die Schule Einzug halten, ganze Wirtschafts-, Rechts-, und Verwaltungsbereiche ins Englische abwandern und somit das Deutsche insgesamt als Sprache gefährdet.
Leander Kurscheidt (Montag, 08 Februar 2021 14:05)
Ich bin schon sehr verwundert über manche dieser Kommentare. Es ist eine technische Universität und zumindest in der Informatik dominiert englisch als Wissenschaftssprache. Konferenzen sind auf englisch, Paper sind auf englisch, Workshops sind auf englisch. Das lässt sich auch zeigen, alle wichtigen Konferenzen sind ausnahmslos auf englisch. Ich sehe die fehlende Internationalität vieler Informatik-Fakultät in Deutschland als eines der großen Probleme, man rekrutiert nur aus seinen eigenen Reihen, aber nicht die internationalen Talente um die man sich eigentlich bemühen müsste. Hier geht es nicht um das Abschaffen des Deutschen insgesamt, sondern um eine einzige technische Universität. Ich sehe das als Gegenpol, der etwas Dynamik in die hier oft erwähnte Mehrsprachigkeit geben kann. Die ist auch warum ich dies so begrüße, ich glaub Deutsch als zweite Sprache an der TUN einzuführen ist im Nachhinein einfach, Englisch kann aber scheitern.