Der jährliche GWK-Bericht zu "Frauen in Hochschulen und Forschung" zeigt nur langsame Fortschritte bei der Gleichstellung. Ein Kommentar.
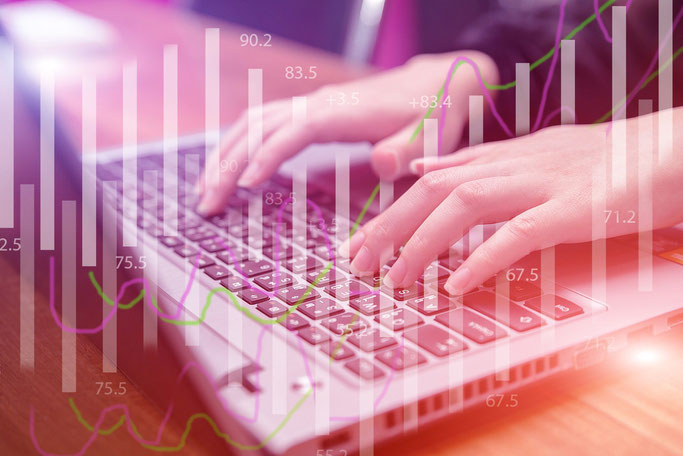
Noch immer machen zu wenige Frauen in Deutschlands Wissenschaft Karriere.
Bild: Nattanan Kanchanaprat / Pixabay.
ES WAR EINE DIESER NACHRICHTEN, die in der zweiten Corona-Welle fast untergegangen sind. Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hat Ende November ihren jährlichen Bericht zu "Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen" veröffentlicht. Es fällt schwer, ihn optimistisch zu lesen.
Ein paar Beispiele: Zwischen 2008 und 2018 ist der Frauenanteil bei den Promovierten um drei Prozentpunkte auf gut 45 Prozent gestiegen. Bei den Habilitierten zwar um acht Prozentpunkte, aber insgesamt liegt er noch immer bei weniger als einem Drittel (31,6 Prozent).
Frauen stellten 2018 weniger als ein Viertel (24,7 Prozent) der Professor*innen, immerhin sieben Prozentpunkte mehr als 2008. Doch je höher die Professuren dotiert sind, desto geringer wird der Frauenanteil. Bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen waren 2018 im Schnitt nur 19,6 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt, was acht Prozentpunkten mehr als vor einem Jahrzehnt entspricht.
Hohe Wachstumsraten bei
niedrigem Ausgangsniveau
Jetzt könnte man sagen: Ist doch gar nicht schlecht. Teilweise enorme Wachstumsraten! Was aber vor allem an dem jämmerlichen Ausgangsniveau liegt. Geht es linear in dem Tempo weiter, dauert es bei den Professor*innen bis zur Parität noch bis ins Jahr 2053. Bei den Außeruniversitären sogar bis 2056.
Was erschütternd genug wäre. Doch es könnte noch länger dauern. Die Soziologin Jutta Allmendinger sagte neulich im Spiegel, durch die Coronakrise würden junge Mütter zurückgestoßen in die Neunziger Jahre, sie spricht von einer "Retraditionalisierung" – mit massiven Folgen für die Gleichstellung.
Die Wissenschaft scheint da keine Ausnahme zu bedeuten. Eine wesentliche Voraussetzung, um in Hochschulen und Forschungsinstituten Karriere zu machen, sind immer noch möglichst viele Publikationen. Schon nach der ersten Corona-Welle hatten Studien ergeben, dass der Anteil von wissenschaftlichen Artikeln mit Frauen als Erstautoren um 27 Prozent gefallen war – was zeitlich mit den Kita- und Schulschließungen zusammenfiel. Im Herbst dann antworteten in einer Umfrage des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) 57 Prozent der Professorinnen, sie hätten seit dem Lockdown weniger Publikationen zur Veröffentlichung eingereicht als geplant. Von den Professoren sagten das nur 37 Prozent.
Mütter mussten weitaus stärker zurückstecken als Väter, die aber auch weniger publizierten als kinderlose Professorinnen. Am unbeeindrucksten von der Krise machten die Professoren ohne Kinder weiter.
Man kann sich damit beruhigen, dass das ja nur eine Umfrage und Selbsteinschätzungen sind. Oder man ist so realistisch zu vermuten, dass auf anderen Karrierestufen die Unterschiede noch extremer sein dürften. Und dann fragt man sich, wie sich dies in den GWK-Berichten zum Tempo der Gleichstellung in vier, fünf Jahren niederschlagen wird. Und wie lange Wissenschaft und Wissenschaftspolitik im Corona-Modus das Thema noch wegdrücken wollen.
Qualitätsverlust für
die Wissenschaft
Was da passiert, ist ungerecht, weil persönliche Lebenschancen verwehrt werden. Vor allem aber bedeutet mangelnde Chancengleichheit in allen ihren Dimensionen, was immer noch zu oft heruntergespielt wird, einen gewaltigen Qualitätsverlust für die Wissenschaft. Weil dann nicht die Besten in der Wissenschaft Karriere machen – sondern die Besten unter denen, die dank ihrer Privilegien durchmarschieren können.
Dieser Beitrag erschien zuerst in meiner Kolumne "Wiarda will's wissen" im Tagesspiegel.
Kommentar schreiben