Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu ändern ist nicht der Schlüssel. Erst wenn alle Beteiligten, von der Politik über die Unileitungen bis zu den Professoren, ihre Verantwortung ernst nehmen, wird sich an den Karrierestrukturen etwas ändern. Ein Gastbeitrag von David J. Green.
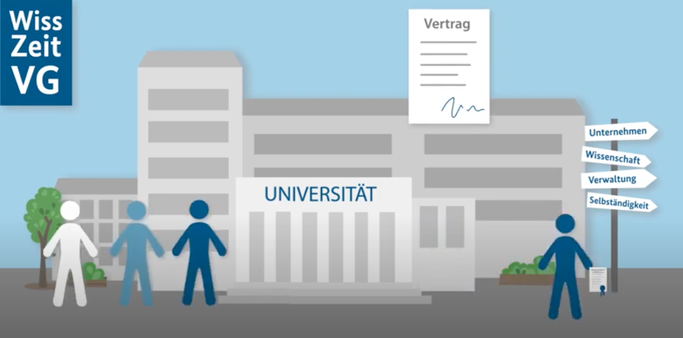
Foto: Screenshot aus dem "Erklärfilm zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz" des BMBF.
WER DIE DISKUSSION "#IchBinHanna" oberflächlich verfolgt, wird denken, am dringendsten sei die Abschaffung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. So verwechselt man aber Symptom und Ursache. Das Grundproblem der Karrierestruktur an den deutschen Universitäten ist, dass zu viele lange Postdoc-Karrieren ermöglicht werden, während es im Anschluss zu wenig dauerhafte Stellen gibt. Wie zu Zeiten Edelgard Bulmahns, so muss auch heute noch eine deutliche Herabsenkung des wissenschaftlichen Alters bei der Erstberufung das wichtigste Ziel sein.
Als Arbeitgeber profitieren Universitäten davon, dass viele junge Wissenschaftler für ihr Fach brennen und eine Berufung verspüren, in ihm tätig zu sein. Gerade in Fächern, wo diese Arbeit für keine außerwissenschaftliche Tätigkeit qualifiziert, halten Postdocs Jahrzehnte beruflicher Unsicherheit aus, qualifizieren sich vollumfänglich für eine Professur – und werden reihenweise im Berufungsverfahren aussortiert, da andere noch mehr Ausnahmeleistungen vorweisen.
Diese Bestenauslese, insofern sie wirklich eine solche ist, muss sein, im Interesse der Wissenschaft und wegen der freien Berufswahl. Doch Beratung reicht nicht aus, da viel Leidenschaft im Spiel ist. Als fürsorgliche, wertschätzende Arbeitgeber dürfen wir die Entscheidung, wer eine langfristige wissenschaftliche Karriere haben darf und wer nicht, künftig nicht so lange hinausschieben. Zumal die Bestenauslese heute auf jene beschränkt ist, die persönlich, sozial oder finanziell überhaupt dazu in der Lage sind, die berufliche Unsicherheit so lange auszuhalten: Eine eingeschränkte Bestenauslese ist aber gar keine.
Der Engländer David J. Green ist seit 2005 Professor für Algebra/Zahlentheorie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seine Postdoc-Zeit dauerte 13,5 Jahre. 2016 bis 2019
war er Dekan der Fakultät für Mathematik und Informatik.
Foto: Anne Günther / Fotozentrum FSU
Jena.

Die Promotionsprüfung ist zu früh, um die Eignung als Hochschullehrende einzuschätzen, aber die Habilitationsäquivalenz ist zu spät. Schon vorher muss die Vorentscheidung fallen, per Tenure-Track-Berufung mit Bestenauslese. Bei der Tenure-Evaluation wird dann lediglich die Bewährung geprüft, hierfür sind bereits zur Berufung klare und durch eigene Leistung realistisch erreichbare Ziele zu vereinbaren. Wobei ich die Eingangsstufe eher "Lecturer auf Probe" nennen würde – mit der Professur als Aufstiegsmöglichkeit, frühestens nach dem "zweiten Buch".
Das System zu ändern, erfordert eine gemeinsame Anstrengung vieler Akteure: Uni-Leitungen, Profs, "Nachwuchs"-Kräfte, DFG, Länder und Bund.
Universitätsleitungen
Uni-Leitungen sind befristet im Amt. Sie stehen unter Druck, Fortschritte bei der internationalen Profilierung der Universität zu erzielen und insbesondere viel Drittmittel einwerben zu lassen. Als die Universität Wuppertal sich 2000 eher als Universität für ihre Region profilieren wollte, erwog das Land Nordrhein-Westfalen sogar ihre Schließung.
Aber manche Drittmittel zählen mehr – oder wissen Sie, wer bei Ihnen am besten im DFG-Großgeräte-Programm abschneidet? Am wichtigsten sind ExStra, SFBs, DFG-Graduiertenkollegs, ERC Grants und Leibniz-Preise. Hierfür braucht man möglichst viele außeruniversitäre Forschungsinstitute in der Nähe. Aber nur ausgegebene Drittmittel zählen. Und bei den prestigeträchtigen Förderlinien ist das meiste Geld für befristetes Personal einzusetzen. Wer jetzt meint, die Uni-Leitungen müssen sich zuerst bewegen, verkennt, dass sie in einem System agieren, dessen Funktionieren einen zuverlässigen Vorrat am Verbrauchsmaterial "Nachwuchskräfte" voraussetzt.
Sobald aber die Anreize korrigiert werden, müssen die Uni-Leitungen sich entsprechend anpassen. Auf die Kanzler und Kanzlerinnen gehe ich nicht gesondert ein. Sie werden gerne vorgeschickt, um unangenehme Botschaften zu verteidigen – siehe Bayreuther Erklärung –, aber die Richtlinienkompetenz liegt anderswo.
Professorinnen und Professoren
In Sonntagsreden ermahnt uns die Politik, mehr Dauerstellen zu schaffen. Ihre Taten sprechen aber eine andere Sprache. Heute kann niemand sich der kompromisslosen Jagd nach leistungsbezogenen Mitteln verschließen, denn sie machen einen so großen Anteil des Universitätshaushalts aus. Wer vorankommen will, lernt, sich stromlinienförmig der Logik der Förderkriterien anzupassen.
Im Sinne dieser Einkünfte-Maximierung sind Dauerstellen Ressourcenverschwendung, da der Forschungsertrag niedriger ist als bei Qualifizierenden, die von der eigenen Karriereunsicherheit unnachgiebig vorangetrieben werden. Die glänzenden Ausnahmen machen die Masse nicht aus. Zur Optimierung der Drittmittelfähigkeit wandelt man Dauerstellen in ein Gemisch aus Qualifizierungsstellen und Juniorprofessuren (mit Tenure Track) um.
Daran können wir Profs wenig ändern. Ja, wir müssen unsere Nachwuchskräfte fördern, nicht überfordern. Aber bei unveränderten Anreizen beschädigten wir die eigene Universität nur, würden wir eine Personalreform durch den Senat drücken. Kommt aber der Systemwechsel, dann dürfen wir – sofern nicht nur die Idee, sondern auch die Details gut sind, denn darunter litt Frau Bulmahns Reform – uns nicht querstellen, wir müssen wohlwollend mitmachen.
"Nachwuchs"-Kräfte
Ich bitte um Verständnis dafür, dass der Beamtenstatus für Profs weg muss. Dies kann berechtigte Sorgen hervorrufen, da die W2-Besoldung 2012 nur wegen des Beamtenrechts für verfassungswidrig niedrig befunden wurde. Leider lebten wir ältere Generationen vor, dass Beamte auf Lebenszeit zu viel Freiheit zum Nichtstun haben: und selbst dann, wenn ein beamteter Professor für sexuell motivierte Annäherungen an seinen Studentinnen rechtskräftig wegen Vorteilsnahme und versuchter Nötigung verurteilt wird, kann man ihn anscheinend nicht aus dem Amt entfernen. Ferner profitieren vom Beamtenstatus am meisten die mit gradlinigen Laufbahnen im deutschen öffentlichen Dienst – unser Wissenschaftssystem muss aber für internationale Spitzenkräfte aller Lebensalter und für Personen mit langer Industrieerfahrung attraktiv sein.
Der heutigen "Nachwuchs"-Generation müssen wir leider sagen, dass gerade eine Reform überproportional vielen den jähen Abbruch der universitären Karriere bringen wird. Im neuen System mit etwas mehr Dauerstellen würden in den ersten drei Jahren leicht mehr berufen werden als bisher. Danach aber würde die Reform ihre Ziele verfehlen, wenn sie das Potenzial der heutigen Promovierenden nicht genau so stark gewichten würde wie die langjährigen Leistungen von Habilitierten mit eigenen Drittmittel. Auch Lehraufträge müssten der Reform zum Opfer fallen. Die Sprechenden von #IchBinHanna betonen, dass sie nicht "Stellen für alle" fordern. Trotzdem werden Rufe nach einer großzügigen Übergangslösung kommen, zumal der Systemwechsel viele zur Unzeit treffen wird. Für einen "Fiebiger-Plan 2.0" – eine Dürre an freiwerdenden Professuren in den 1980er Jahren begegnete man mit zahlreichen sehr weit vorgezogenen Nachbesetzungen – wird es aber kaum zusätzliches Geld geben.
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Nichts in den letzten Jahren motivierte meine Kollegen so stark, mehr Frauen zu berufen, als die Erwartungen der DFG über antragstellende Hochschullehrenden bei Forschungsverbünden. Vermutlich überträte die DFG ihre Befugnisse, würde sie Verbünde-Bewilligungen an eine nachhaltige Karrierestruktur koppeln. Sie sollte aber ihre Förderkriterien so verändern, dass Unis, die voranpreschen, nicht darunter leiden: So hat man zum Beispiel bei einer Departmentstruktur keine Haushaltsbeschäftigte, die ohne DFG-Förderung am Projekt mitwirken. Aber selbst dann hätten die Reformwilligen einen strukturellen Nachteil im Bieterkampf um Koryphäen, denn nur unreformierte Universitäten können eine Ausstattung an Stellen anbieten.
Länder
Den Ländern kommt die Hauptaufgabe zu. Sie müssen die Grundfinanzierung deutlich und nachhaltig erhöhen, sonst ist jeder Ruf nach Dauerstellen ein Hohn. Sie müssen eine Personalstruktur schaffen, die eine frühe Entscheidung für oder gegen eine langfristige universitäre Karriere vorsieht, und jenen, die bleiben dürfen, attraktive Entwicklungschancen bietet. Um Deutschland international als einheitlichen Wissenschaftsraum zu vermarkten, liegt es im Interesse der Länder, sich zu koordinieren. Dazu gehört auch eine pauschale Regelung, dass Nicht-Muttersprachler drei Jahre bekommen, um die deutsche Sprache zu erlernen.
Als Pendant zu den Entwicklungschancen ist eine Schwachstelle des deutschen Systems zu korrigieren: Auch in der W-Besoldung haben wir Profs zu wenig "Skin in the Game", um das viel beschworene Leistungsprinzip bei Besetzungsverfahren sogar noch vor den eigenen Privatinteressen (die Seilschaft, das Freundschaftsnetzwerk, das Fortführen der eigenen Tradition, usw.) zu setzen.
Bund
Der Bund muss einsehen, dass eine verbesserte Grundfinanzierung im Interesse der Bundesrepublik liegt. Jenen Ländern, die sich dieser Verantwortung stellen, sollte er einen Teil – zum Beispiel 25 Prozent – des Aufwuchses dauerhaft gegenfinanzieren. Falls nötig wird das Grundgesetz geändert. Im Gegenzug sind andere BMBF-Programme auf den Prüfstand zu stellen, wobei die für das Ansehen des Wissenschaftsstandorts Deutschland so wichtige Deutsche Forschungsgemeinschaft und Max-Planck-Gesellschaft zu schonen sind.
Bund und Länder müssen alle Anreize so ändern, dass sie reformkonformes Verhalten belohnen.
Und die Studierenden?
Ob die Studierenden den Unterschied merken, wenn die Lehrkräfte besser planbare Karrieren haben? Es ist ein bleibendes Rätsel, warum kaum jemand in Deutschland sich für Lehrqualität zu interessieren scheint. Über Lehrquantität werden Verordnungen erlassen. Für Innovationen gibt es eine eigene Stiftung. Aber die schlichte Qualität der Lehre? Das wäre aber ein Thema für einen anderen Tag.
Kommentar schreiben
Klaus Diepold (Mittwoch, 01 September 2021 11:59)
ich erlaube mir ein kleine Ergänzung für die Liste der agierenden Interessensgruppen. Ich rede von den Fachkollegien/Fachausschüssen. Die Fachkollegien manifestieren die fachspezifischen Kulturen, die oft angeführt werden, als Grund warum Änderungen oft nicht möglich sind oder zumindest nicht möglich erscheinen.
Dazu führe ich als Beispiel die fachspezifische Weigerung an Doktorand:innen ein volles Gehalt (100% E13) zu bezahlen. Was fachspezifisch bei Ingenieuren der Normalfall ist es beispielsweise in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern fachspezifisch usus eher 1/2 Stellen oder bestenfalls 2/3 zu bezahlen. Den schwarzen Peter dafür bekommt oft die DFG. Die widerum verweist auf die Fachkollegien, die dies so festlegen.
Es bräuchte also nicht einmal eine Gesetzesänderung, um an diesem Umstand der systematischen Unterbezahlung etwas zu ändern. Die Fachkollegien/-ausschüsse könnten das einfach ändern. Was natürlich bei einer gleichbleibenden Menge an Geld auch zu einer Reduzierung der verfügbaren Qualifikationsstellen führt.
Tina Salomon (Mittwoch, 01 September 2021 12:29)
"Ich bitte um Verständnis dafür, dass der Beamtenstatus für Profs weg muss."
Das ist der Punkt, an dem ich entschieden widersprechen möchte (aber das ist auch der einzige Punkt). Ich gehe mittlerweile ja sehr offen mit meiner persönlichen Geschichte um (hier in den Leserkommentaren & auf Twitter). In meiner Geschichte geht es um (mögliche) Vorteilsannahme, Betrug und Nötigung (die Nötigung habe ich auch angezeigt), also finanziell, nicht sexuell motivierten Machtmissbrauch, aber die Folgen für mein Leben waren identisch. Da die Ereignisse mein Leben und mich als Mensch regelrecht zerstört haben, sollte man glauben, dass ich eine entschiedene Gegnerin des Beamtenstatus für Professoren bin. Das ist aber nicht der Fall, weil - mMn - nicht der Beamtenstatus das Problem ist, sondern die Weigerung der Universitätsleitungen, das Disziplinarrecht auf Professor:innen so anzuwenden, wie es bei anderen Beamt:innen geschieht. Wenn Sie sich die Urteile des BVerwG ansehen, werden Sie sehen, dass die Verwaltungsgerichte sehr (sehr!) viel strenger urteilen als die Strafgerichte und z.B. bei Strafbefehlen korrigierend wirken: Ein Strafbefehl tut nicht wirklich weh, die Enthebung aus dem Beamtenstatus aber sehr. Die Fälle von Professor:innen kommen aber - weil die Universitäten die Dienstherreneigenschaft haben und auf die Erhebung von Disziplinarklagen verzichten - nur selten vor die Verwaltungsgerichte. Ggf. müsste der Gesetzgeber sich das Disziplinarrecht noch mal angucken, denn es gibt Lücken: Da eine Professur ein laufbahnfreies Amt ist, kann z.B. nicht zurückgestuft werden. Und da dann die nächstschwächere Maßnahme gewählt werden muss (zeitweilige Einbehaltung von Bezügen) scheint es, als würde auch auf gravierendes Fehlverhalten nur sehr schwach reagiert. Aber das Problem ist nicht der Beamtenstatus, sondern dass die Möglichkeit, den inhärenten Exzesse im System mit dem Disziplinarrecht zu begegnen, nicht genutzt wird. Einer Reihe von Verhaltensweisen, die Leidensdruck schaffen, wie unnötig kurzfristige Beschäftigung oder zu kurzfristige Verlängerung von befristeten Verträgen, könnte als "unkollegiales Verhalten" disziplinarrechtlich geahndet werden.
Edith Riedel (Donnerstag, 02 September 2021 09:19)
Der Hinweis zu den Fachkollegien ist sehr valide. Dort sitzen allerdings auch nur wieder die Professor*innen, die es "geschafft haben". Und jede*r einzelne denkt bei den Empfehlungen natürlich an die Auswirkungen in der eigenen Arbeitsgruppe. Schon jetzt klafft die Finanzierung von DFG-geförderten Promovierenden und Promovierenden auf Hausstellen auseinander (mit Ausnahme der Ingenieurwissenschaften). Keine*r möchte in der eigenen Gruppe erklären müssen, warum einzelne Promovierenden 65%- oder gar 100%-Stellen bekommen, während die hausfinanzierten auf den 50%-Stellen sitzen. Es sind im übrigen nicht nur die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer, in denen 50%-Stellen der Usus sind, da ist z.B. auch die Chemie ganz vorne mit dabei. Ohne politischen Druck oder Vorgaben der DFG geht da gar nichts. Die Umstellung von Stipendien auf sozial- und rentenversicherte Stellen war ja auch keine Entwicklung, die von den Fachkollegien bottom-up durchgesetzt wurde. Das kam top-down von der DFG, und wird heute gerne noch als Grund dafür genannt, dass man jetzt nicht mehr so viel publizieren könne, weil mit dem gleichen Geld ja weniger Stellen als Stipendien finanziert werden können.
McFischer (Donnerstag, 02 September 2021 09:32)
Ein guter Beitrag, der neue Perspektiven in der Diskussion eröffnet!
Dennoch: wenn ich Sätze lese wie
"Als Arbeitgeber profitieren Universitäten davon, dass viele junge Wissenschaftler für ihr Fach brennen und eine Berufung verspüren, in ihm tätig zu sein" graust es mich immer etwas. Letztlich ist das eine 'hire & fire'-Denkweise, die in anderen Arbeitsfeldern sich in Deutschland glücklicherweise nie hat wirklich durchsetzen können. Am ehesten noch in der Branche von McKinsey & Co ("up or out") - irgendwie ironisch, dass gerade die Bewahrer der alten Universität, die sich gerne als Bollwerk gegen den Neoliberalismus sehen, genau diesem Prinzip verschreiben.
Michael Liebendoerfer (Donnerstag, 02 September 2021 10:33)
Vielen Dank für diesen Beitrag! Die Komplexität hinter der Hanna-Problematik wird gut verdeutlicht. Ich nehme mit, dass Leistung und Wettbewerb auf vielen Stufen ihre Spuren hinterlassen.
Ein Elefant steht aber nahezu unbesprochen im Raum: Selbst wenn man sich einig ist, "dass zu viele lange Postdoc-Karrieren ermöglicht werden" und das Ziel ist, "eine Personalstruktur [zu] schaffen, die eine frühe Entscheidung für oder gegen eine langfristige universitäre Karriere vorsieht" - wie würde das im Fall einer Entscheidung gegen die Wissenschaft funktionieren?
Während wir uns ja für die Allgemeinheit sehr einig sind, dass die unsichere Karrierephase viel zu lange dauert, agieren wir in unseren persönlichen Einzelfällen genau andersherum. Profs und WiMis basteln gemeinsam an "Lösungen" der Art, dass Verträge nochmal um ein Jahr verlängert werden, irgendwelche Stellen zur Überbrückung gefunden werden, die Diss auf ALG 1 fertig geschrieben wird, Lehraufträge zur Verbesserung des Profils vergeben/angenommen werden usw. - kurz: einige Wissenschaftskarrieren werden zu lange am Leben erhalten.
Wer also sollte die befristete Weiterbeschäftigung verhindern? Hanna selbst liebt ihr Fach zu arg (und hat vielleicht wenig Alternativen an der Hand). Hannas Betreuer:in will ihr helfen (ehrlich!) und freut sich über eine engagierte, eingearbeitete Mitarbeiterin. Hannas Hochschulleitung will Hanna aus purem Eigeninteresse die Möglichkeit geben, noch Drittmittel einzuwerben und sich auch sonst keinen Standortnachteil gegen den Willen der Professor:innen verschaffen.
Es müsste also politisch gehen: Bund und Länder müssten die Hochschulen nicht nur zu mehr Dauerstellen drängen, sondern auch dazu, Leute mit geringen Chancen auf eine Dauerstelle (gegen deren Willen) nicht weiterzubeschäftigen. Das scheint mir eine sehr heikle Geschichte, aber wie gesagt, dieser Elefant steht im Raum.
Ruth Himmelreich (Donnerstag, 02 September 2021 14:05)
Herr Liebendoerfer hat den Elefanten benannt, so ist es, leider. Ich frage mich, ob man ihn in bewährter Weise bürokratisch domptieren wird - im Zweifel über die DFG, die einen neuen Parameter zur Antragsberechtigung einer Hochschule erfindet, z.B. die Begrenzung des Anteils der Postdocs, die länger als 6 Jahre nach der Promotion beschäftigt sind.
LG51 (Donnerstag, 02 September 2021 15:56)
Frau Himmelreich hat eine gute Idee benannt: Begrenzung
der Antragsberechtigung von Postdoc durch die DFG nach mehr als sechs Jahren. In diesem Zusammenhang müßten
sich die Unis zu einer Entscheidung über Tenure track (oder eben nicht) durchringen. Die Frist von 6 Jahren entspricht ja in etwa auch der maximalen Dauer einer W1-Stelle. An meiner Uni gibt es mit W1-Stellen in Mathematik eigentlich nur ausgezeichnete Erfahrungen.