Das war's
Die Aufklärung der Fördermittelaffäre ist nicht vollständig, aber vorbei ist sie nach der letzten Sitzung des Forschungsausschusses trotzdem. Ein Kommentar.

"Kintsugi heißt die japanische Kunst, zerbrochene Keramik mit Gold zu reparieren".
Foto: Pomax / flickr, CC BY-NC-ND 2.0.
ES FÜHLTE SICH wie der letzte Akt an. Ein müder letzter Akt. Übergangs-Forschungsminister Cem Özdemir (Grüne) trat am Mittwochmorgen wie verlangt vor dem Bundestags-Forschungsausschuss auf, um Rede und Antwort zum Aufklärungsstand der Fördermittelaffäre zu stehen. So, wie es seine Vorgängerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) schon zweimal getan hatte.
Das mit dem letzten Akt galt in vielerlei Hinsicht. Es war die voraussichtlich letzte Sitzung des Ausschusses in dieser Legislaturperiode, in dem vor allem Union und Linke nie lockergelassen hatten mit ihren Fragen zu den Vorgängen im BMBF, seit Berliner Hochschullehrende Anfang Mai einen Offenen Brief verfasst hatten zur Unterstützung eines von der Polizei aufgelösten propalästinensischen Protestcamps an der Freien Universität.
Es war auch die voraussichtlich letzte Sitzung mit dem Ausschussvorsitzenden Kai Gehring (Grüne), der nicht wieder für den Bundestag antritt. Özdemir wird zwar noch bis zur Vereidigung einer neuen Bundesregierung im Amt bleiben, aber danach ist für ihn ebenfalls definitiv Schluss. Auch er kandidiert nicht mehr für den Bundestag, sondern will im Herbst in Baden-Württemberg Ministerpräsident werden.
Das Gefühl des müden letzten Aktes kam vor allem aber auch daher, dass die Befragung Özdemirs überhaupt keine neuen Erkenntnisse mehr brachte. Dass aber auch die Abgeordneten nicht so wirkten, als hätten sie noch mit solchen gerechnet. Sie spulten je nach Fraktionszugehörigkeit routiniert ihre Rolle ab, von staatstragend bis empört. Der Minister wiederum gab eine souveräne Vorstellung, die seine Vorgängerin nicht einmal in Ansätzen bei keinem ihrer zahlreichen Auftritte im Ausschuss hinbekommen hatte, auch nicht bei den vielen, in denen es nicht um die Affäre und ihre Rolle darin ging.
Inhaltlich hielt er sich eng an das, was sein Ministerium in den Tagen zuvor kommuniziert hatte, seit der Abschlussbericht der Internen Revision des Ministeriums vorlag. Die Hauptbotschaft: Das Verwaltungshandeln im Ministerium ist aufgeklärt, es gibt keine Anzeichen für ein Fehlverhalten auf Verwaltungsebene. "Ich will den Mitarbeitern im Haus gern sagen: Ihr habt nichts falsch gemacht, ihr habt richtig reagiert", sagte Özdemir im Ausschuss.
Am Kern der Affäre vorbei
Eine verbale Wiedergutmachung einem Ministerium gegenüber, das unter der Affäre arg gelitten hatte. Was allerdings nicht an der öffentlichen Berichterstattung lag. Denn die hatte bewusst immer unterschieden zwischen Vorwürfen der Hausleitung gegenüber und der Arbeit der Ministerialbeamten und Projektträger, die sich, wie später veröffentlichte hausinterne E-Mails zeigten, teilweise offen gegen Aufträge gestellt hatten, eine Liste der geförderten Wissenschaftler zusammenzustellen oder eine zuwendungsrechtliche Prüfung vorzunehmen.
Insofern war die Kommunikation Özdemirs fürs BMBF wichtig, ging aber wie schon in den vergangenen Tagen am Kern der Affäre vorbei. Die drehte sich stets um die Fragen, welche Rolle die Hausleitung um Stark-Watzinger bei der Erteilung der umstrittenen Aufträge gespielt und wer was gewusst hatte. Bis zu der Frage, wie es sein konnte, dass der förderrechtliche Prüfauftrag laut Darstellung zwar rasch zurückgenommen wurde, der zuständige BMBF-Referatsleiter aber von den Projektträger-Mitarbeitern weiter die Liste einforderte.
Kurz: Nicht das Verwaltungshandeln stand in der Kritik, sondern das Handeln der politisch Verantwortlichen – und ihr Einfluss auf das Verwaltungshandeln. Doch entscheidende Fragen dazu, das steht jetzt fest, werden unbeantwortet bleiben.
Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste: In dieser Legislaturperiode ist keine Zeit mehr. Alle blicken nur noch auf die Wahl. Das gilt auch und gerade für jene Oppositionsabgeordneten, die derzeit auf die Pauke hauen und "Skandal" rufen. Längst ist in ihren Äußerungen nicht mehr die Sacharbeit vom Wahlkampfmodus zu unterscheiden. Das gilt aber auch für Özdemir, dessen Hauptziel daran besteht, das BMBF intern wieder in ruhigere Fahrwasser zu lenken und nach außen die Beziehungen zur Wissenschaft zu kitten.
Bald Vergangenheit aus der vorigen Legislaturperiode
Nicht aus reiner Selbstlosigkeit: Mit seiner präsidialen Art schielt er schon auf das nächste von ihm angestrebte Amt, dazu passt jetzt kein Klein-Klein mehr. Ebenso ist absehbar: Der nächste Bundestag wird sich, Stichwort letzter Akt, nicht erneut der Fördermittelaffäre widmen, sondern sie als Vergangenheit aus der vorigen Legislaturperiode betrachten.
Es ist müßig, an dieser Stelle noch einmal alle Ergebnisse des Berichts aufzuzählen oder die Schlussfolgerungen, die Özdemir daraus gezogen hatte – oder eben auch nicht. Fest steht: Auch Özdemir hat der von Stark-Watzinger gefeuerten Ex-Staatssekretärin Sabine Döring nicht erlaubt, vor dem Ausschuss ihre Version der Ereignisse darzustellen. So bleibt es bei der Feststellung der laut Interner Revision "nicht aufklärbaren Widersprüche" an zwei zentralen Stellen, Özdemir sprach von "unterschiedlichen Wahrnehmungen", die man wegen fehlender Dokumentation und Zeugen hinnehmen müsse.
Eine weitere Aufklärung der "Wire"-Chats, von denen nur die von Ex-Staatssekretärin Döring nachträglich zur Akte gegebenen Auszüge vorliegen, wird es ebenfalls nicht mehr geben. Die Union kritisiert die "Schattenkommunikation" der früheren Ministeriumsspitze, auch die SPD sieht einen "einmaligen Vorgang" darin, dass über vorgeblich private Kanäle dienstliche Kommunikation gelaufen sei.
Gleichzeitig argumentiert das BMBF abwechselnd damit, dass die "Wire"-Nachrichten entweder keine Relevanz fürs Verwaltungshandeln gehabt hätten und keine amtlichen Informationen darstellten oder dass das BMBF auf viele der Chats, da auf Privathandys gelaufen, keinen Zugriff habe.
Özdemir macht "Kintsugi"
Im Antwortbrief auf einen vor wenige Tagen verschickten Protestbrief der Unionsfraktion verweist Özdemir unter anderem auf das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln, demzufolge der Bund die Server der "Wire Swiss GmbH" nicht kontrollieren könne. "Entsprechend hat der Bund auch keinerlei Zugriff auf Nachrichten, die mit 'Wire (privat)' versendet werden". Und Özdemir ergänzt: "Für eine Verpflichtung, einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
BMBF, ihre privaten Mobiltelefone auszuhändigen, um diese auf einzelne
Kommunikationsinhalte zu überprüfen, sehe ich keine Handhabe."
Vielleicht ist die Sache mit den Wire-Chats am Ende ja folgende: Viele Ministerien nutzen Messengerdienste, und keines dürfte Interesse daran haben, hier dem Parlament detaillierte Einblicke in die Verläufe zu geben. Wo überall wohl sonst noch Privathandys dafür eingesetzt werden? Jeder Präzedenzfall im BMBF hätte unweigerlich Auswirkungen auf die – oftmals womöglich stillschweigend geduldete – Praxis der Chatnutzung auch anderswo.
"Kintsugi heißt die japanische Kunst, zerbrochene Keramik mit Gold zu reparieren", schrieb der ZEIT-Newsletter Wissen3 am Donnerstagmorgen zu Özdemirs Auftritt vor dem Forschungsausschuss. Genau das hat der Minister versucht, nicht mehr und nicht weniger, und genau damit endete der letzte Akt der Fördermittelaffäre.
Kommentare
#1 - (Hoffentlich) Nicht als Besserwisser, nur zur…
Es mag sein dass Herr Özdemir im Herbst Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden möchte; die nächste Landtagswahl steht allerdings im Frühjahr 2026 an - was übrigens auch erklärt warum hier die inhaltlich richtige Schulreform hin zu G 9 ab Sommer 2025 so unsäglich durchgepeitscht wird. Aber das ist ein anderes Thema...




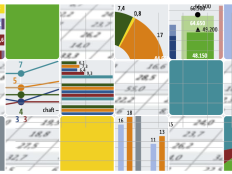


Neuen Kommentar hinzufügen