"Ich werde mich auf die Seite der Kinder und Jugendlichen stellen"
Bundesministerin Karin Prien über Generationengerechtigkeit, politische Prioritäten in einer alternden Gesellschaft, die Verhandlungen mit den Ländern um Digitalpakt, Startchancen & Co – und die Rolle ihres Hauses.

Karin Prien, 60, war acht Jahre lang Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein und 2022 Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Seit drei Jahren ist Prien stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, hat das Bildungskapitel des schwarz-roten Koalitionsvertrags maßgeblich mit ausgehandelt und steht seit dem 6. Mai an der Spitze des neu zusammengesetzten Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Foto: Dominik Butzmann/BMBFSFJ/photothek.de.
Frau Prien, als Lisa Paus, Ihre Vorgängerin an der Spitze des damaligen Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, kurz BMFSFJ, 2022 ins Amt kam, lautete eines ihrer ersten Pressestatements, das "S" für Senioren im Kürzel ihres Ministeriums werde oft zu leise ausgesprochen. "Das will ich ändern", kündigte Paus an. Jetzt wurde das BMFSFJ um die Zuständigkeit für Bildung erweitert. Sprechen Sie als Ministerin das neue "B" im Kürzel künftig besonders laut aus?
Die Erweiterung des Hauses um die Verantwortung für Bildung ist zunächst einmal eine echte Stärkung. Denn die Bildungskette zieht sich durch alle Lebensphasen: von der frühkindlichen Bildung über die Schule und Berufsausbildung bis zum lebenslangen Lernen. Insofern ergeben sich für die Bildung Schnittstellen zu allen bisherigen Bereichen dieses Hauses: Bildung und Familie, Bildung und Jugend, aber auch Bildung und Alter. Wenn man es richtig versteht und ganzheitlich denkt, dann gehören alle diese Bereiche zusammen. Die Kunst wird es sein, die Logik der Bildungskette politisch so zu steuern, dass auch wirklich neue Synergien entstehen.
Wie wollen Sie in der Öffentlichkeit am liebsten genannt werden? Bildungsministerin? Familienministerin?
Natürlich möchte ich, dass alle Bereiche sichtbar werden – Familien- und Frauenpolitik genauso wie die Belange älterer Menschen. Wenn die Menschen künftig sagen "Bildungs- und Familienministerin", kann ich jedoch gut damit leben.
In der Corona-Zeit haben Sie sich als Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und KMK-Präsidentin für offene Schulen eingesetzt. Die Belange der Kinder und Jugendlichen dürften in einer alternden Gesellschaft nicht hinten runterfallen, lautete Ihre Forderung. Wie setzen Sie in Ihrer neuen Rolle ein politisches Signal für mehr Generationengerechtigkeit zugunsten junger Menschen, ohne die Älteren zu verprellen?
Die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen gehen im politischen Alltag viel zu oft unter. Ich bin weiter davon überzeugt: Kinder und Jugendliche brauchen in unserer alternden Gesellschaft eine stärkere Stimme – und sie brauchen Menschen in der Politik, die sich ganz bewusst auf ihre Seite stellen. Das werde ich tun. Und zwar ohne die Generationen gegeneinander auszuspielen. Unsere gemeinsamen Herausforderungen lassen sich nur lösen, wenn wir sie auch gemeinsam angehen.
Beispiel Einsamkeit: Ich habe gerade ein von meinem Ministerium gefördertes Mehrgenerationenhaus in Berlin-Zehlendorf besucht – und es war berührend zu sehen, wie viel es gerade auch den älteren Menschen bedeutet, wenn sie an solchen Begegnungsorten mit Jüngeren Zeit verbringen, Teil eines lebendigen Miteinanders sind. Genau darin liegt eine Chance: Wenn wir Räume schaffen, in denen Jung und Alt einander wirklich begegnen, entsteht gesellschaftlicher Zusammenhalt. Natürlich brauchen die Jüngsten wie die Älteren auch Angebote, die auf ihre spezifische Lebenssituation eingehen. Aber ich bin überzeugt: Vieles lässt sich besser denken, wenn wir es zusammen denken.
"In einer alternden Gesellschaft bedeutet Generationengerechtigkeit eben auch,
den Blick auf die zu richten, die eine schwächere Lobby haben –
und das sind häufig die Jüngeren und Jüngsten."
Aber oft wird man sich doch für eine Priorität entscheiden müssen. Sie zum Beispiel haben das gerade erst getan, als Sie ein Pflegegeld als Lohnersatz für pflegende Angehörige eine sinnvolle Reform nannten, gleichzeitig aber betonten, für Sie hätten zunächst die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen Vorrang.
Dies ist für mich kein Widerspruch. Wenn sich der Fachkräftemangel weiter zuspitzt und unsere Gesellschaft gleichzeitig immer älter wird, werden wir mehr Pflege zu Hause organisieren müssen. Und wer Angehörige pflegt, der braucht nicht nur gesellschaftliche Anerkennung, sondern auch arbeitsrechtliche Absicherung und perspektivisch eine finanzielle Unterstützung. Meine Botschaft war: Ja, ein solches Pflegegeld wäre eine Sozialleistung, die gut zu unserer veränderten gesellschaftlichen Realität passen würde und die obendrein auch noch volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Im Koalitionsvertrag haben wir uns darauf verständigt zu prüfen, wie ein solches Instrument aussehen könnte.
Grundsätzlich haben wir uns in der schwarz-roten Koalition jedoch ehrlich gemacht: Wir können nicht einfach neue Leistungen einführen, ohne auf die bestehenden zu schauen – auf ihre Wirksamkeit, ihre Effizienz, und auf das, was unser Staat finanziell überhaupt leisten kann. Deswegen ist es entscheidend, dass wir zunächst alles dafür tun, die wirtschaftliche Basis unseres Landes zu stärken. Auf dem Weg dahin ist auch das BMBFSFJ gefragt: Um unsere wirtschaftliche Zukunft zu sichern müssen wir dafür sorgen, dass mehr Menschen – gerade auch mehr Frauen, die das wollen – in Vollzeit arbeiten können. Dafür müssen wir bei der Kinderbetreuung und Bildung ansetzen, aber zum Beispiel auch bei der Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen.
Abwägungen, Maß und Mitte werden in der Politik immer nötig sein. In einer alternden Gesellschaft bedeutet Generationengerechtigkeit eben auch, den Blick auf die zu richten, die eine schwächere Lobby haben – und das sind häufig die Jüngeren und Jüngsten.
Meinen Sie, dass eine solche Parteinahme für die junge Generation bei den Älteren auf Zustimmung stößt?
Aus dem Grund formuliere ich es ja so deutlich. Mein Eindruck ist: Viele ältere Menschen sehen selbst, dass wir mehr für Kinder und Jugendliche tun müssen, für unsere Kitas, Schulen und für die Jugendhilfe. Und sie sind bereit, dafür ihre eigenen Interessen, wo nötig, ein Stück zurückzustellen und mehr Verantwortung für die junge Generation zu übernehmen – mehr, als man ihnen manchmal zutraut.
Vielleicht müssen wir aufhören, im Zusammenhang mit Älteren immer sofort darüber zu sprechen, was für Kosten sie verursachen – und stärker ihre Lebensleistung würdigen, welchen großartigen Beitrag ältere Menschen für unser Miteinander leisten: als länger Berufstätige, als Seniorexperten, als Mentoren, im Ehrenamt, als Großeltern, als engagierte Mitglieder in Mehrgenerationenhäusern oder in Familienzentren. Sie können eine enorme Unterstützung für junge Familien sein! Auch in Gesprächen mit Seniorenvertretungen höre ich immer wieder: Wir wollen helfen, wir wollen gebraucht werden. Aber dafür brauche es die richtigen Gelegenheiten – Räume, Formate, Strukturen, in denen dieses Engagement möglich wird. Mein Haus unterstützt solche Brücken zwischen den Generationen.
Im schwarz-roten Koalitionsvertrag steht eine Passage, die maßgeblich auf die frühere SPD-Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz, Stefanie Hubig, und Sie zurückgehen dürfte – weil Sie beide zusammen mit Ihrer grünen Kollegin aus Baden-Württemberg, Theresa Schopper, schon Anfang des Jahres einen vielbeachteten Aufschlag dazu gemacht hatten. Wie wollen Sie als Bundesbildungsministerin im Föderalismus alle Länder auf eine solche Verbindlichkeit einschwören?
In meiner neuen Rolle für den Bund ist mein Leitmotiv ein kooperativer Föderalismus. Als Bund wollen wir mit den Ländern im Dialog sein anstatt Vorgaben zu machen.
Auch wenn wir über Bildungsziele sprechen, dann geht das nur gemeinsam mit den Ländern – denn die verfassungsmäßige Kompetenzverteilung respektiere ich ausdrücklich. Mein Ziel ist es, einen gemeinsamen Verständigungsprozess anzustoßen. Ich bin überzeugt dies gelingt nicht über eine lange Liste von Wunschvorhaben, sondern am besten über einige wenige, dafür aber klare, ambitionierte und messbare Ziele.
In der Bund-Länder-Vereinbarung zum Startchancen-Programm steht, dass bis zum Ende der Programmlaufzeit die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Mindeststandards in Mathematik und Deutsch verfehlen, an den Startchancen-Schulen halbiert werden sollen. In Ihrem gemeinsamen Aufschlag mit Hubig und Schopper tauchte zum Beispiel auch das Ziel auf, die Quote der Schulabbrecher bis 2035 zu halbieren. Ein Ziel, das Sie gerade erneuert haben.
Ja, das ist keine neue Idee, aber eine sehr wichtige. In einem Staat wie Deutschland können wir es uns nicht leisten, so viele junge Menschen zu verlieren. Ohne Schulabschluss fehlt nicht nur ihre Kraft auf dem Arbeitsmarkt, Bildung gibt ihnen auch das Selbstbewusstsein, sich mündig, lebendig und engagiert in die Gesellschaft und damit letztlich in unsere Demokratie einzubringen. Deswegen müssen wir die Menschen auf ihrem Weg zu einem Schulabschluss bestmöglich unterstützen und Chancen zum Durchstarten eröffnen.
Und was die Möglichkeiten des Bundes angeht, Anreize zu setzen: Wir können die Länder unterstützen – durch Forschung, durch die Entwicklung von diagnostischen Instrumenten oder konkreten modellhaften Förderprogrammen. Genau das ist unser Hebel: gute Rahmenbedingungen schaffen und dabei mit den Ländern gemeinsam wirksame Maßnahmen verabreden. Wann immer wir als Bund den Ländern etwas anbieten, werden wir künftig auch über messbare Ziele reden. Das ist insgesamt unser Anspruch als Koalition: nicht nur fördern, sondern auch konkrete strategische Ziele vereinbaren und dann auch überprüfen, was tatsächlich wirkt.
"Aus meiner Sicht funktioniert der Föderalismus nur,
wenn wir auch wissen, was in den Ländern gut läuft,
warum es gut läuft, und was andere davon
möglicherweise adaptieren können."
Messbare Bildungsziele erfordern vergleichbare und transparente Bildungsdaten. In der Realität herrscht an der Stelle ein traditionelles Misstrauen: Der Bund beklagt, von den Ländern zu wenig belastbare Primärdaten zu bekommen – und die Länder fürchten, dass der Bund zu tief in ihre Zuständigkeiten eingreift. Wie wollen Sie dieses Spannungsverhältnis auflösen? Und wie lässt sich ein echter Datenraum Bildung schaffen, der Transparenz ermöglicht, ohne den Föderalismus zu untergraben?
Der Weg führt über ein gemeinsames Bildungsregister – und ja, dessen Umsetzung ist ein dickes Brett. Aber das Ergebnis wäre ein Durchbruch.
Natürlich sind die sozioökonomischen Rahmenbedingungen unterschiedlich, Bremen ist nicht Bayern und umgekehrt. Voraussetzung für ein gemeinsames Bildungsregister ist, dass wir Vertrauen aufbauen zwischen Bund und Ländern und ein gemeinsames Verständnis davon entwickeln, wie der Föderalismus besser funktionieren kann. Aus meiner Sicht funktioniert er nur, wenn wir auch wissen, was in den Ländern gut läuft, warum es gut läuft, und was andere davon möglicherweise adaptieren können. Die Grundlage für solche datenbasierten Erkenntnisse müssen die Länder untereinander legen. Der Bund bräuchte die Möglichkeit, diese Daten selbstverständlich anonymisiert und ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke zu nutzen. Dafür kommt es auf ein intelligentes, kontextsensibles Datenverständnis an.
Ich halte wenig von der aktuellen Praxis, alle paar Jahre die Ergebnisse von Vergleichstests pauschal nebeneinanderzustellen, woraufhin es drei Tage Aufregung gibt – und dann passiert: wenig.
Der Aktionsrat Bildung hat gerade sein Jahresgutachten vorgelegt und fordert ebenfalls mehr Verbindlichkeit in der Bildungspolitik auf allen Ebenen – und eine Rückkehr zum PISA-Bundesländervergleich. Dessen Abschaffung 2009 sei "symptomatisch" gewesen "für einen fehlenden Wunsch nach klarer Transparenz der Leistungsentwicklung". Stimmen Sie zu?
Ich halte das Gutachten des Aktionsrats Bildung insgesamt für sehr gelungen. Es ist kein Zufall, dass erfahrene Bildungsministerinnen und -minister, Wissenschaftler und Stiftungen inzwischen zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen – und das mit einem anderen Ton als noch vor wenigen Jahren. Es geht längst nicht mehr um Systemumstürze oder starre Schulstrukturdebatten, sondern um evidenzbasierte Schul- und Unterrichtsentwicklung. Das finde ich ausgesprochen erfreulich.
Die Frage, wie wir das Bildungsmonitoring künftig organisieren, ist wichtig – gehört allerdings ans Ende eines Prozesses, nicht an den Anfang. Gleichzeitig finde ich es, Stichwort PISA-Bundesländervergleich, absolut diskussionswürdig, über ein neues Benchmarking nachzudenken – mit mehr Transparenz und Verbindlichkeit. Aber solche Schritte müssen von den Ländern gemeinsam beschlossen werden. Der Bund kann hier nicht einseitig vorangehen.
Wo wollen Sie denn an der Stelle Impulse setzen?
Das Register gibt die Stoßrichtung vor: Wir brauchen in Deutschland dringend eine effektivere Implementierungsforschung. Wir brauchen dringend mehr Wissen darüber, wie Schul- und Unterrichtsreformen tatsächlich in der Praxis wirken und besser umgesetzt werden können. Am Ende muss klar sein: Was nützt der Schülerin, dem Schüler, der Lehrkraft konkret im Alltag?
Unsere Rolle als Bund verstehe ich als Partner. Wir können als Bund gern in einzelnen Ländern Modellprojekte unterstützen, um gezielt Erfahrungen zu sammeln, von denen am Ende alle profitieren. So sieht für mich der kooperative Föderalismus in der Praxis aus.
"Die frühe und verpflichtende Sprachdiagnostik und -förderung
im Vorschulalter gehört für mich zu den prioritären
Zielen des Bundes in dieser Legislatur."
Sie haben es vorhin gesagt: Die große Chance Ihres neu zusammengesetzten Ministeriums besteht darin, unterschiedliche Politikfelder stärker zusammenzudenken. Besondere Hoffnungen setzen Bildungsforscher auf die Stärkung der Kitas als Bildungsorte und die Übergänge zwischen Kitas und Schule. Was bedeutet das für die angesprochene Ausweitung des Startchancen-Programms? Werden die rund 4.000 Startchancen-Schulen künftig von einem Ring an geförderten Kitas umgeben sein?
Ich bitte um Verständnis, dass wir in dieser frühen Phase noch mitten in der Zusammenführung der bislang getrennt arbeitenden Ministeriumsbereiche sind – und gerade zwischen frühkindlicher Bildung und Schule besteht eine zentrale Schnittstelle. Hier müssen die zuständigen Abteilungen – Bildung einerseits, frühkindliche Förderung andererseits – jetzt in einen klugen und konstruktiven Abstimmungsprozess treten.
Aber ja, es ist genau, wie Sie es beschreiben: Wir wollen die um die bestehenden Startchancen-Schulen liegenden Kitas gezielt stärken – mit Blick auf Sprachförderung, sozial-emotionale Kompetenzen, mathematische Vorläuferfähigkeiten und motorische Entwicklung. Wenn wir es schaffen, Kinder bereits in der Kita gezielt zu fördern, dann können wir die teils gravierenden Unterschiede in den Lernausgangslagen beim Schuleintritt deutlich verringern.
Wir wollen ein bundesweites flächendeckendes Sprachscreening für alle Kinder am Übergang von Kita und Schule. Dazu gehören perspektivisch auch verbindliche Tests für alle Kinder und eine bedarfsgerechte und verpflichtende Sprachförderung. Die frühe und verpflichtende Sprachdiagnostik und -förderung im Vorschulalter, etwa bei vierjährigen Kindern, gehört für mich zu den prioritären Zielen des Bundes in dieser Legislatur.
Lassen Sie uns über Geld sprechen. Viele hoffen, dass mit dem neuen Sondervermögen auch eine Aufstockung der geplanten Digitalpakt-Fortsetzung möglich wird. Derzeit will der Bund 2,5 Milliarden zahlen. Sind Sie bereit, nachzulegen – auch wenn die Länder ihrerseits nichts nachlegen würden?
Der Digitalpakt 2.0 ist in der vergangenen Legislatur weitgehend ausverhandelt. Mir ist vor allem wichtig, dass wir jetzt zügig zu einem Abschluss kommen – und zwar noch in diesem Jahr. Die Schulträger brauchen Planungssicherheit, damit anstehende Investitionen nicht ins Stocken geraten.
Grundsätzlich gilt: Wir haben gemeinsam mit den Ländern neben der Digitalisierung eine Reihe weiterer großer Investitionsvorhaben vor uns – vom Schulbau über berufliche Schulen bis hin zu überbetrieblichen Ausbildungsstätten und Kitas. Bund und Länder müssen das Sondervermögen jetzt in die Bildung investieren.
Das Investitionsprogramm Ganztagsausbau soll um zwei Jahre verlängert werden, den dazu gehörenden Gesetzesentwurf hat das Bundeskabinett gerade verabschiedet – auf ausdrücklichen Wunsch der Länder und Kommunen, wie Sie sagen. "Die Bundesmittel von 3,5 Milliarden Euro stehen nun bis 2029 bereit, das schafft verlässliche Planungsgrundlagen." Was ist mit der Planungssicherheit der Familien? Wackelt der für den 1. August 2026 versprochene Rechtsanspruch auf Ganztag?
Der Rechtsanspruch ist verbindlich gesetzlich geregelt. Ab August 2026 werden zunächst alle Grundschulkinder der ersten Klassenstufe den Anspruch erhalten, der Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Damit hat ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung.
Gute Ganztagsbetreuung gelingt nur mit Verlässlichkeit und realistischem Blick auf die Herausforderungen vor Ort. Deshalb ist es richtig, dass wir die Länder und Kommunen effektiv unterstützen, diese Angebote weiter auszubauen – denn Planungsverfahren dauern, oft fehlen Fachkräfte oder Lieferengpässe bremsen Vorhaben vor Ort. Länder und Kommunen haben in den letzten Jahren bereits viel geleistet und ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote stark ausgebaut. Die Bundesmittel von 3,5 Milliarden Euro sollen nun zwei Jahre länger bis 2029 angerufen werden können – das schafft verlässliche Planungsgrundlagen. So kann weiter an guten und erreichbaren Angeboten für jedes Grundschulkind gearbeitet werden.
Unser Ziel ist klar: bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mehr Qualität, mehr Plätze und echte Unterstützung für mehr Bildungsgerechtigkeit. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir als Bundesregierung und Koalitionsfraktionen als erstes einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht haben, der die ausdrücklichen Wünsche von Ländern und Kommunen umsetzt. Dies soll auch ein Zeichen der neuen und besseren föderalen Zusammenarbeit sein.
"Entscheidend ist, dass sich alle
auf den Weg machen,
Kinder besser zu schützen."
Gerade erst haben Sie als Bundesbildungsministerin dafür plädiert, die private Handynutzung an Grundschulen zu verbieten. Sollten Sie das jetzt nicht Ihren früheren Länderkollegen überlassen? Die wollen, so scheint es, gar keinen gemeinsamen Beschluss dazu fassen.
Ich halte das Thema für absolut relevant – auch wenn manche sagen, es gäbe noch keine eindeutige Evidenz für den positiven Effekt eines Verbots. Doch wir sehen zunehmend klare empirische Hinweise: Zu frühe und zu intensive Bildschirmzeiten beeinträchtigen Konzentration, soziale Kompetenzen und können Kinder sogar traumatisieren – etwa durch Kontaktmöglichkeiten mit sexualisierter Gewalt.
Natürlich findet vieles davon außerhalb der Schule statt. Aber daraus zu schließen, dass Schule hier nichts tun müsse, wäre zu kurz gedacht. Schule muss ein Schutzraum sein – und sie muss gemeinsam mit Eltern Orientierung geben: Was ist sinnvoller Medienkonsum, was nicht? Deshalb bin ich klar dafür, private Handynutzung im Schulalltag zu untersagen – mit Ausnahmen für gezielte medienpädagogische Angebote.
Auch wenn jedes Bundesland einen etwas anderen Weg geht: Entscheidend ist, dass sich alle auf den Weg machen, Kinder besser zu schützen.
Bei der Konferenz der Jugend- und Familienminister geht es diese Woche um mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Was ist Ihr Befund?
Die aktuellen Zahlen deuten darauf hin, dass sich die Lage seit der Corona-Pandemie etwas gebessert hat, was wir auch gehofft hatten. Aber die psychischen Belastungen der Kinder und Jugendlichen bleiben – durch anhaltende Krisen, veränderte Familienkonstellationen und einen Alltag, der für viele nicht mehr stabil wirkt.
Deshalb ist das Thema mentale Gesundheit eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung und Aufgabe – und vor allem eine gemeinsame Herausforderung für Gesundheitswesen, Schulen und Jugendhilfe. Haben wir genug Therapieangebote, sowohl in der Psychotherapie als auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie? Aus meiner Erfahrung in Schleswig-Holstein würde ich sagen: nein. Eine bundesweite Bedarfsanalyse ist deshalb wichtig.
Schule kann eine wichtige Rolle spielen. Nicht als Ersatz für therapeutische Fachkräfte, aber als Ort, an dem frühzeitig erkannt wird, wenn Kinder Hilfe brauchen. Dafür müssen Lehrkräfte in ihrer Ausbildung sensibilisiert werden – mit einem klaren Verständnis, wo ihre Verantwortung endet und wo professionelle Unterstützung beginnt. Und dazu müssen wir die Hilfesysteme besser miteinander verzahnen.
Mit welcher konkreten Botschaft an Ihre Länderkolleginnen und -kollegen gehen Sie in die Sitzung?
Ich gehe auch in diese Sitzung mit der Einladung zu einer möglichst vertrauensvollen und intensiven Zusammenarbeit – mit klarem Respekt vor den föderalen Strukturen, aber genauso mit dem Anspruch, die Hilfesysteme besser an die Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen heranzuführen.
Die zweite Botschaft ist: Lasst uns gemeinsam kämpfen für eine stärkere Bedeutung von Bildungs- und Familienpolitik.
Es geht darum, vorhandene Ressourcen effektiver zu nutzen und zu verzahnen – in der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe ebenso wie in der Zusammenarbeit zwischen Schulen, Jugendhilfe und Eingliederungshilfe. Mein Eindruck ist: Auch vonseiten der Jugendministerinnen und -minister gibt es ein großes Interesse an mehr Kooperation, auch in Zusammenarbeit mit der Bildungsministerkonferenz etwa im Kontext der geplanten gemeinsamen Empfehlungen zur Förderung sprachlicher und mathematischer Vorläuferfähigkeiten.
Dabei geht es nicht nur um inhaltliche, sondern auch um kulturelle Verständigung: Ich habe am Tag der Kinderbetreuung eine beeindruckende Kita mit einem innovativen Konzept besucht – ein Familienzentrum, vielfach ausgezeichnet. Doch sobald das Gespräch auf die Grundschule kam, wurde deutlich: Der Austausch fehlt, das Vertrauen auch. Man spürte regelrecht die Distanz zwischen den pädagogischen Welten. Das würde ich gern ändern.
Kommentare
#1 - Sprachdiagnostik
"Die frühe und verpflichtende Sprachdiagnostik und -förderung im Vorschulalter gehört für mich zu den prioritären Zielen des Bundes in dieser Legislatur."
Das sagt Frau Prien, und so sehen es auch etliche Bildungswissenschaftler. Aber andere (politisch vielleicht anders orientierte) Bildungswissenschaftler meinen schon, die Sprachdiagnostik sei "diskriminierend", sie wittern "Segregation" und bemängeln die "Einsprachigkeit" dieser Tests:
https://uni-paderborn.sciebo.de/s/yTdKDH84pzywNwN
Es ist nicht zu sehen, wie jemals eine Einigkeit darüber erzielt werden kann, wie die Kinder im Vorschulalter am besten zu fördern sind. Art. 6 GG sagt, dass die Erziehung allein den Eltern obliegt, und wenn die sich um deutsche Sprachkenntnisse der Kinder nicht bemühen, dann dürfen sie das halt. Dem Art. 6 widerspricht das nicht, anderen Regeln offenbar auch nicht. Das scheint einfach eine Kehrseite der Migration zu sein, die die Experten vielleicht auch vorher schon hätten sehen können.





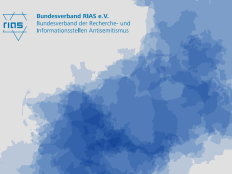


Neuen Kommentar hinzufügen