Zwischen Mahnung und Deutung
Der neue RIAS-Bericht zeigt: Antisemitismus in Deutschland nimmt drastisch zu – und führt zu einer Debatte über Ursachen, Begriffe und politische Verantwortung.
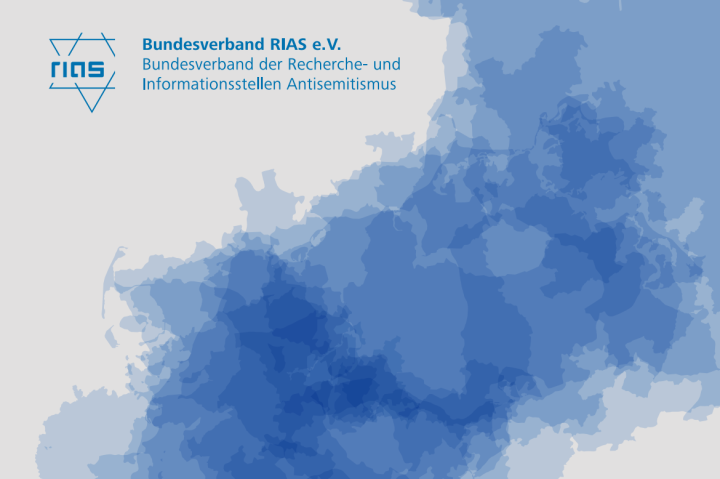
Titelseite des RIAS Jahresbericht 2024 (Ausschnitt).
SO ATEMBERAUBEND der Anstieg ist, so wenig überraschend kommt er – leider. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) veröffentlichte vergangene Woche seinen Jahresbericht für 2024. Die darin dokumentierten 8.627 antisemitisch motivierten Vorfälle bedeuten ein Plus von fast 77 Prozent gegenüber 2023.
Mit dem 7. Oktober 2023 habe für viele Juden eine neue Zeitrechnung begonnen, hieß es bereits im RIAS-Bericht von 2023. "Ein Jahr später wird der tiefe Einschnitt, den die Massaker der Hamas und anderer Terrorgruppen in Israel bei vielen Jüdinnen_Juden auslösten, immer greifbarer.“
Nach wie vor seien Israelis Geiseln der Hamas und anderer Gruppen, nach wie vor fürchte Israel Angriffe durch Hamas, Iran, Hisbollah oder die jemenitischen Huthi. "Und nach wie vor ereignen sich weltweit antisemitische Vorfälle in einem dramatischen Ausmaß – auch in Deutschland." Das Ausmaß und die Qualität antisemitischer Vorfälle hierzulande ähnelten auch 2024 stark dem Zustand unmittelbar nach den Massakern.
Das Spektrum im RIAS-Jahresbericht reicht von acht Fällen extremer Gewalt – laut Definition solche, "die den Verlust von Menschenleben zur Folge haben können sowie schwere Körperverletzungen" –, über 186 weitere körperliche Angriffe, 443 gezielte Sachbeschädigungen, 300 Bedrohungen bis hin zu 7.514 Fällen verletzenden Verhaltens. Zu Letzteren zählt RIAS auch 176 Massenzuschriften und 1.802 Versammlungen.
"24 antisemitische Vorfälle am Tag"
"24 antisemitische Vorfälle am Tag", kommentierte Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland. "Darunter Fälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, die polizeilich nicht erfasst und demnach nicht verfolgt werden. RIAS wirft ein Schlaglicht auf dieses große Dunkelfeld antisemitischer Gewalt in Deutschland und legt Zeugnis über einen Alltag ab, der für viele Jüdinnen und Juden zunehmend von Anfeindungen und Hass geprägt ist."
Ein paar Beispiele, was sich hinter den statistischen Kategorien verbirgt. Stichwort extreme Gewalt: Ein Anhänger des Islamischen Staates (IS) tötete auf dem Solinger Stadtfest drei Menschen und verletzte acht weitere teilweise schwer. In einem IS-Bekennervideo sagte der Attentäter, der Anschlag sei unter anderem ein Racheakt für die palästinensische Bevölkerung gewesen, die Massaker mit Unterstützung von "Zionisten" erleiden müsse. In die Kategorie "extreme Gewalt" zählt RIAS auch den Angriff auf den jüdischen Studenten Lahav Shapira in Berlin, der von einem Mitstudenten arabischer Herkunft schwer verletzt wurde.
Stichwort körperliche Angriffe: In Oldenburg, berichtet RIAS, hätten zwei Männer eine jüdische Schülerin auf dem Schulweg festgehalten, bedroht und beschimpft als "dreckiger Jude" – bevor sie sich habe befreien können. Stichwort Bedrohungen: In Kiel wurden im gesamten Stadtgebiet Aufkleber verteilt mit dem Aufruf, "Zionisten mal zu Hause [zu] besuchen", zusammen mit einem Foto vom Wohnort sowie Adresse konkreter Betroffener. Stichwort Sachbeschädigungen: Allein in Weimar wurden in 15 Fällen Stolpersteine mit Säure übergossen, weitere mit den Worten "Juden sind Täter" beschmiert.
Unter den Vorfällen verletzenden Verhaltens wiederum führt der Bericht etwa einen Schweriner Taxifahrer an, der im Gespräch mit einem Fahrgast über den Vermieter seiner Tochter sagte, dieser sei Jude und Israeli – "daher sei es nicht verwunderlich, dass seine Tochter so viel Miete zahlen müsse".
Kritik an RIAS – und die Antwort darauf
Der RIAS-Bericht spricht von "dokumentierten Fällen". Doch laut Jüdischer Allgemeiner gibt es auch Kritik am RIAS-Vorgehen. Der israelische Journalist Itay Mashiach wirft RIAS in einer Publikation der "Diaspora Alliance" "Voreingenommenheit, Einseitigkeit und mangelnde Transparenz" vor. Es sei fraglich, ob "klare und nachvollziehbare" Daten vorlägen. Zudem werde israelbezogener Antisemitismus überbetont – fast jede öffentliche palästinensische Veranstaltung gelte laut Mashiach als potenzieller Fall für die Statistik.
RIAS weist die Kritik zurück. Die Recherche der "Diaspora Alliance" enthalte "zahlreiche falsche Tatsachenbehauptungen, Auslassungen und nicht belegbare Vorwürfe", so der Bundesverband. Eine wissenschaftliche Entgegnung sei in Arbeit. Geschäftsführer Benjamin Steinitz sprach von einer gezielten Diskreditierung. Zum Vorwurf der Intransparenz erklärte RIAS, wie in der Opferberatung üblich bestimmten die Betroffenen selbst, wie mit ihren Daten umgegangen werde – viele Fälle würden deshalb anonymisiert. Man folge Standards der Sozialforschung und lege die Methodik offen, einschließlich der IHRA-Definition von Antisemitismus.
Diese ist weit verbreitet, wird aber auch kritisiert, da sie jede Kritik an der israelischen Politik als potenziell antisemitisch einstufe.
Zurück zum Bericht: Die Zahl der von RIAS dokumentierten antisemitischen Vorfälle an Hochschulen hat sich 2024 gegenüber dem Vorjahr verdreifacht – von 151 auf 450. Gegenüber 2022 (23) bedeutet das sogar eine Verzwanzigfachung. Weniger beleuchtet war laut RIAS bislang die Situation an Schulen, wo 284 Vorfälle gezählt wurden – darunter 19 Angriffe, von denen sich 17 direkt gegen jüdische oder israelische Schüler richteten.
Mit Äxten ins Uni-Präsidium
Zahlreiche der von RIAS angeführten Hochschul-Vorfälle machten bundesweit Schlagzeilen, etwa als im Oktober 2024 rund 40 Personen ins Präsidiumsgebäude der Freien Universität Berlin eindrangen und Mitarbeiter bedrohten – laut FU "vermummt und mit Äxten, Sägen, Brecheisen und Knüppeln bewaffnet." Zurück blieben antisemitische Schmierereien, darunter der Slogan "From the river to the sea, Palestine will be free" und rote Dreiecke – ein von der Hamas genutztes Feindsymbol.
Nahezu 90 Prozent der Vorfälle an Hochschulen hätten Stereotype des israelbezogenen Antisemitismus reproduziert, bilanziert RIAS. Eine wichtige Rolle spielten dabei die 147 Versammlungen an Hochschulen, die RIAS als antisemitisch einstufte. So habe es bei einem Sit-in in Jena geheißen: "Wer die Völker unten hält, hat gegen sich die ganze Welt", es seien antisemitische Lieder abgespielt, Israel sei als Kolonialstaat bezeichnet und mit NS-Deutschland gleichgesetzt worden: "Der siedlerkoloniale Staat hat demnach kein Existenzrecht. Sonst hätte das Dritte Reich das auch gehabt."
Im April 2025 verglich die AG Hochschulforschung der Universität Konstanz in einer zweiten Befragung antisemitische Einstellungen unter Studierenden und in der Gesamtbevölkerung. Rund sechs Prozent der Studierenden zeigten ein "ausgeprägtes antisemitisches Weltbild" – gegenüber 20 Prozent in der Gesamtbevölkerung. Die Forscher sprachen von einem "vergleichsweise niedrigen Niveau" antisemitischer Haltungen unter Studierenden.
Warum ausgerechnet die Hochschulen?
Wieso aber ereignen sich an Hochschulen dann so häufig antisemitische Vorfälle, und wieso werden diese besonders prominent wahrgenommen? Der RIAS-Bericht liefert eine differenzierte Einordnung: Hochschulen seien Orte politischer Auseinandersetzung. Es sei "zumindest nicht ausgeschlossen", dass ein relevanter Teil der Vorfälle nicht von Hochschulangehörigen ausgegangen seien, sondern von externen Akteuren, die gezielt an Universitäten mobilisierten, um Studierende zu erreichen. "Im Rahmen dieser politischen Mobilisierungen kommt es dann zu antisemitischen Vorfällen."
Für die Betroffenen, aber auch für das Ausmaß von Antisemitismus in einer Gesellschaft, hätten antisemitische Vorfälle an Hochschulen eine besondere Bedeutung. "Zum einen sind Jüdinnen_Juden auf den Besuch der Institution Hochschule angewiesen, wollen sie bestimmte Bildungsabschlüsse erreichen. Sie können dem Antisemitismus an Hochschulen daher nicht einfach ausweichen, wie sie das vielleicht in anderen gesellschaftlichen Kontexten können. Zum anderen ist es besonders besorgniserregend, wenn antisemitische Vorfälle von Studierenden oder Mitarbeitenden von Hochschulen ausgehen, da man annehmen kann, dass diese überdurchschnittlich oft Teil gesellschaftlicher Eliten sind oder sein werden."
Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), sagte, der Bericht zeige "auf bedrückende Weise, dass Antisemitismus in Deutschland weiterhin stark verbreitet ist". Die Hochschulen dürften "in ihren Anstrengungen zur Prävention nicht nachlassen".
Wenn sich von persönlichen Angriffen, Bedrohungen und Beleidigungen betroffene Jüdinnen und Juden aus Angst zurückzögen, wenn sie aus Angst ihre jüdische Identität in der Öffentlichkeit versteckten, verletze das "elementare Werte unserer Hochschulen und unserer demokratischen Gesellschaft. Dem müssen wir uns alle ohne Wenn und Aber entgegenstellen." Hochschulen seien zur Bühne für antisemitische Aktionen geworden, weil sie als Orte akademischer Bildung und Forschung eine besondere Sichtbarkeit hätten. "Die Aktivist:innen zielen darauf ab, Hochschulen als öffentliche Räume aggressiv zu dominieren und Antisemitismus zu normalisieren."
Der Streit um den "importierten Antisemitismus"
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wurde während seines US-Besuchs in einem Interview mit Fox News auf die Zahlen angesprochen. Laut Agenturen verwies er dabei auf "eine Art importierten Antisemitismus mit dieser großen Zahl von Migranten", die man seit 2015 in Deutschland habe.
Eine Formulierung, die Saba-Nur Cheema und Meron Mendel im Januar zu ihrem persönlichen "Unwort des Jahres" erklärten. Cheema ist Publizistin und Politologin, Mendel Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Während die feste Jury "biodeutsch" auswählte, entschieden sich die beiden als diesjährige Gastjuroren für "importierten Antisemitismus". Der Ausdruck suggeriere, "dass Judenhass insbesondere mit dem Zuzug von Migrantinnen und Migranten (aus arabischen Ländern) zu einem Problem geworden sei" – und diene vor allem in rechten Kreisen der Ausgrenzung und Ablenkung vom eigenen Antisemitismus.
Warum Friedrich Merz den Begriff dennoch wählte, bleibt seine Sache. Fest steht, dass antisemitische Haltungen, Aussagen, Verhaltensweisen, Straf- und Gewalttaten waren im Nachkriegsdeutschland immer präsent waren. Und dass, siehe die Konstanzer Befragungen, der Antisemitismus weit verbreitet ist in der Bevölkerung.
Der RIAS-Bericht wiederum zeigt: Auch vor dem 7. Oktober 2023 gab es einen breiten Bodensatz antisemitischer Vorfälle. 2020 zählte RIAS 1.957 Fälle, 2021 waren es 2.773, 2022 dann 2.610. Zu der Zeit stand das Thema Antisemitismus weniger im öffentlichen Fokus – was das für die damalige Ausleuchtung des Dunkelfelds bedeutet, von dem Josef Schuster sprach, bleibt offen.
Schlussstrich-Forderungen "aus allen Richtungen"
Der Zentralratsvorsitzende sieht mit Blick auf 2024 eine beunruhigende Entwicklung bis in die gesellschaftliche Mitte: Zum ersten Mal seien mehr Menschen in Deutschland für einen "Schlussstrich" unter die NS-Zeit als dagegen. Es sei kein Zufall, dass die häufigste Erscheinungsform, der israelbezogene Antisemitismus, oft Hand in Hand gehe mit Angriffen auf die Erinnerung an die Shoah. "Wir sehen das aus allen politischen Richtungen."
Gerade deshalb sei die Arbeit von RIAS so wichtig, "vor allem in Anbetracht aktueller gesellschaftlicher Debatten, in denen einerseits versucht wird, israelbezogenen Antisemitismus zu relativieren und andererseits die Notwendigkeit staatlich geförderter Demokratiebildung in Frage gestellt wird".
Angesichts der vorläufigen Haushaltsförderung im Bund fürchteten zuletzt viele gesellschaftliche Projekte um ihre Finanzierung. Das bundesweite Förderprogramm "Demokratie leben“ des Bundesfamilienministeriums, aus dem auch der Bundesverband RIAS Unterstützung erhält, war Anfang des Jahres erst in letzter Minute verlängert worden, Bescheide wurden laut tagesschau.de zunächst nur für ein Jahr ausgestellt.
Ein Demokratiefördergesetz, das laut Ampel-Koalitionsvertrag der "verbindlichen und langfristig angelegten Stärkung der Zivilgesellschaft" dienen sollte, war von der AfD heftig bekämpft worden und kam am Ende nicht mehr zustande. Die FDP-Fraktion, so tagesschau.de, hatte klarere Kriterien gefordert, welche Art von Demokratie-Engagement gefördert werden sollte.
Kurz vor der Bundestagswahl hatte schließlich die CDU-/CSU-Bundestagsfraktion, damals noch Opposition, im Februar 2025 per Kleiner Anfrage die "Politische Neutralität staatlich geförderter Organisationen" ins Visier genommen.
In seiner Kommentierung des RIAS-Jahresberichts forderte Schuster, zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Antisemitismus wie RIAS müssten auch in Zukunft finanziell abgesichert werden. "Zudem braucht es flächendeckende Fortbildungen bei Sicherheitsbehörden und Justiz."








Neuen Kommentar hinzufügen