"Bis in die Nacht"
So viel Nettigkeit war selten: Bundesbildungsministerin Prien und ihre Länderkolleginnen zeigen bei ihrem Treffen an der Ostsee so viel demonstrative Einigkeit, dass sie jetzt nicht nur bei der Digitalpakt-Fortsetzung liefern müssen.

Foto: Gary Cassel / Pixabay.
SIE SEI SELBSTVERSTÄNDLICH der Einladung von BMK-Präsidentin Simone Oldenburg gern gefolgt, sagte Karin Prien gleich zu Beginn der Pressekonferenz, "und ich werde auch den ganzen Tag bis in die Nacht heute hier bleiben."
Neun Jahre lang war die CDU-Politikerin selbst Mitglied der Kultusministerkonferenz und zuletzt der neuen Bildungsministerkonferenz, doch am BMK-Treffen auf Schloss Bothmer in Klütz in Mecklenburg-Vorpommern nahm sie erstmals in ihrer neuen Rolle als Bundesbildungsministerin teil.
Eine Ministerin, die bleibt
Bleiben "bis in die Nacht": eine bemerkenswerte Aussage vor dem Hintergrund, dass es sich bei diesem Donnerstag um Priens Geburtstag handelte, noch dazu um ihren 60. Geburtstag. Ihre Vor-Vorgängerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hatte in den vergangenen Jahren aus deutlich weniger nachvollziehbaren Gründen Termine mit ihren Länderkollegen ausfallen lassen, und wenn sie denn kam, war sie meist schnell wieder weg.
Doch Prien fühlte sich sichtlich wohl, wie sie da vor den Journalisten in einer Reihe saß mit den Spitzen der BMK. Die ihrerseits keine Gelegenheit ausließen, ihr Wohlgefallen über ihre vertraute Besucherin auszudrücken.
Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot, Koordinatorin der SPD-Seite etwa, die hervorhob, "dass wir mit der Bundesministerin eine Expertin haben, die weiß, was auf dem Tisch liegt und die jetzt dafür gesorgt hat, dass, was auf dem Tisch liegt, auch mit den finanziellen Möglichkeiten hinterlegt wird."
Da ging es, wie die meiste Zeit über, um den geplanten Digitalpakt 2.0 und die 2,5 Milliarden Euro Bundesgeld dafür, deren Verankerung im "Sondervermögen Infrastruktur" Prien zuvor verkündet hatte.
Es war schwer, Streichert-Clivots Bemerkung nicht auf Stark-Watzinger zu beziehen – bei der ihre Landesminister vergangenes Jahr wiederholt den Verdacht geäußert hatten, sie habe das für die Digitalpakt-Fortsetzung nötige Geld noch gar nicht beschafft. Was, so Prien, tatsächlich so gewesen sei: Sie wolle ehrlich sagen, "vorher gab es keine Vorsage durch die vorhergehende Bundesregierung für die Finanzierung", aber das sei ja jetzt gelungen.
Ganz offensichtlich auf Stark-Watzinger gemünzt war auch die Bemerkung von Streichert-Clivots CDU-Pendant, NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller, die sagte, es sei immer gut, wenn man sich bei der Zusammenarbeit kenne. Prien habe bis vor kurzem auf der Seite der Landesbildungsminister gesessen, "ich habe den Eindruck, sie bleibt auch auf unserer Seite."
Zelebration des guten Miteinanders
Nach den Disharmonien der vergangenen Jahre, die schon während der Amtszeit von Kurzzeit-BMBF-Chef Cem Özdemir freundlichen Tönen gewichen waren, fiel die öffentliche Zelebration des guten Miteinanders so überschwänglich aus, dass es fast schon wieder zu dick aufgetragen wirkte.
So dick, dass ein anwesender Journalist von "kognitiver Dissonanz" sprach, angesichts der gleichzeitig verschickten Pressemitteilung, in der die Landesminister von der Bundesregierung in strengem Ton die "zügige Wiederaufnahme der Gespräche zum Digitalpakt 2.0" forderten. Hatte Gastgeberin Oldenburg nicht gerade noch frohlockt, "endlich" sei es soweit, "das Geld ist da, und wir können mit der Arbeit beginnen"? Und es sei wichtig, "dass wir heute endlich den Startschuss geben können"?
Oldenburg, die linke Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern, deutete in ihrer Antwort die Forderung behende zu einem Lob um: "Ich glaube, so zügig wie die Bundesministerin jetzt unterwegs ist, kann man dann sagen, dann wird es doch umgehend erfolgen, also ich denke, dass wir das noch in diesem Jahr beginnen können."
Woraufhin ihr Prien natürlich ihrerseits wiederum zustimmte.
Pressemitteilung statt Konfrontation
Bei all der Harmonie war nicht mehr überraschend, dass auch keine der anwesenden Ministerinnen noch einmal das Fass aufmachen wollte, dass die Länder eigentlich eine Aufstockung der 2,5 Bundesmilliarden verlangt haben, seit der Bund sein Sondervermögen beschlossen hat. In der Pressemitteilung steht diese Forderung allerdings noch drin: Es "soll geprüft werden, in welcher Weise das bislang angedachte Gesamtvolumen des Digitalpakts 2.0 aus Mitteln dieses Sondervermögens erhöht werden könnte".
Doch die Konfrontation wollten die Landesministerinnen sich und Prien offenbar ersparen, hatte die doch, nachdem das Bundeskabinett am Dienstag den Haushaltsentwurf für 2025 samt Sondervermögen beschlossen, recht unmissverständlich deutlich gemacht, dass es das mit den 2,5 Milliarden bundesseitig dann auch war. Mehr noch, sie drehte den Spieß um. Die Länder sollten jetzt ihrerseits möglichst viel aus ihrem Anteil am Sondervermögen für Investitionen in Bildungsinfrastruktur ausgeben. Auch in der BMK-Pressemitteilung wird Prien zudem mit dem Satz zitiert: "Der Bund liefert. Jetzt sind Sie am Zug."
Noch ein Beispiel dafür, dass die Ministerinnen ihre Konflikte lieber schriftlich per Pressemitteilung austrugen, als damit die Nettigkeit des Beisammenseins belasten zu wollen.
Erfolg als Verpflichtung
Aber es gab ja auch außer der Sicherung der 2,5 Milliarden tatsächlich weitere gute Nachrichten. Etwa, dass das Geld jetzt nicht auf sechs Jahre gestreckt, sondern innerhalb von nur vier Jahren fließen soll. Oder dass Prien, wie sie sagte, vier weitere vier Milliarden aus dem Sondervermögen für Bildung und Betreuung habe reservieren können. Schön wäre es gewesen zu erfahren, ob diese vier Milliarden ganz oder teilweise identisch sind mit der jährlich einen Milliarde für Bildung, die die Länder, wie Anfang der Woche durchsickerte, als Kompensation für Steuerausfälle vom Bund erhalten sollen. Die BMK jedenfalls weiß es offenbar selbst nicht. "Bitte erkundigen Sie sich beim Bund bzw. in den Finanzministerien der Länder", hieß es am Freitag auf Anfrage.
Aus Sicht der Länder positiv hervorzuheben war auch die Bemerkung Priens auf eine Journalistennachfrage, dass die vom Ampelkabinett beschlossene Regel, die Länder müssten bei allen künftigen Bund-Länder-Programmen mindestens 50 Prozent beisteuern, für die neue Regierung nicht mehr gelte. Gleich zweimal sicherte die Bundesministerin außerdem zu, die Abwicklung des Digitalpakts für die Länder so einfach und so schnell wie möglich zu machen. "Die Finanzierung mit dem Sondervermögen ermöglicht eben auch eine relativ bürokratiearme Umsetzung." Und: "Bei neuen Prozessen, bei allem, was wir tun, ist der Anspruch, mit weniger Bürokratie auszukommen. Das ist ein Credo, das wir uns als Bundesregierung insgesamt gegeben haben und an dem wir uns auch messen lassen müssen."
Apropos messen lassen: Das gilt natürlich auch für dieses Schauspiel der ministerialen Eintracht zwischen Bund und Ländern. Wie lange wird, wie lange kann sie halten? Fest steht: Nach den Eklats mit Ex-Bildungsministerin Stark-Watzinger wollen Prien und ihre Länderkolleginnen unbedingt zeigen, dass es anders, dass es besser gehen kann. Mit jeder Beschwörung erhöhen sie umgekehrt den Einsatz, denn die Ernüchterung, wenn es doch irgendwann zu einem scharfen, öffentlich ausgetragenen Konflikt zwischen ihnen kommen sollte, würde entsprechend immer größer ausfallen. Eine Erkenntnis, die weit über die Digitalpakt-Verhandlungen hinausreicht: Prien und die Landesbildungsministerinnen verdammen sich gerade zum gemeinsamen Erfolg.
Nachtrag am 27. Juni:
Warum haben BMK-Präsidentin Oldenburg und ihre Länderkolleginnen in der Pressekonferenz mit Prien nicht ihre Forderung erneuert, die 2,5 Digitalpakt-Milliarden aufzustocken? Oldenburg sagte am Freitag auf Anfrage, mit den 2,5 Milliarden halte sich der Bund an seine Zusagen. "Der DigitalPakt 2.0 ist gesichert." Bund und Länder könnten zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht sagen, ob dieses Geld ausreicht. "Im Moment gibt es aber noch gar kein Geld für die Länder und der Druck in den Schulen steigt. Wir müssen jetzt loslegen. Das Signal der Bundesministerin, dass es jetzt losgehen kann, hat uns als Länder sehr gefreut." Eine Forderung der Länder sei übrigens auchgewesen, dass diese 2,5 Milliarden mit weniger Bürokratie ausgegeben werden könnten. "Das hat uns die Bundesministerin ebenfalls zugesichert. Wir sehen deswegen den Beschluss der Bildungsministerkonferenz als Erfolg."
Handyverbot, Föderalismus und eine Botschaft aus Hessen
So sehr Karin Prien und ihre Länderkollegen das Verhältnis zueinander und das Fortkommen beim Digitalpakt in den Vordergrund stellten, die breite Öffentlichkeit dürfte sich auch heute für ein nur mittelbar damit zusammenhängendes Thema interessiert haben: Wie ist denn das nun mit dem diskutierten Handyverbot in der Schule – oder aber mit der von Prien vorangetriebenen Debatte über ein mögliches Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche?
Tatsächlich hatten es beide Themen erneut nicht auf die offizielle Tagesordnung der BMK geschafft, wurden aber dem Vernehmen nach beim inoffiziellen Kaminabend besprochen. Dass die Länder sich in Sachen Smartphone nicht per Beschluss auf eine einheitliche Marschlinie verständigen werden, hatte sich schon länger abgezeichnet. Ein bundeseinheitliches Handyverbot könne es nicht geben, sagte Oldenburg, "weil wir im Föderalismus leben." Aber die Empfehlungen der einzelnen Länder lägen gar nicht weit voneinander entfernt.
Die Argumentation der BMK-Präsidentin, die Bildungshoheit der Länder verhindere das, entsprach allerdings wohl weniger der wirklichen Ursache als den doch deutlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen einigen Ländern. Denn schließlich besteht ja eine der Aufgaben der BMK genau darin: sich mit allen 16 Ländern, wo nötig, auf gemeinsame Vorgehensweisen zu verständigen.
Fast wie eine Botschaft Richtung BMK wirkte da die Pressemitteilung des hessischen Bildungsministers Armin Schwarz (CDU) nur wenige Stunden später, in der er die Verabschiedung eines Gesetzes zur Einrichtung von "Smartphone-Schutzzonen" an den hessischen Schulen pries, im Klartext: ein grundsätzliches Verbot der privaten Handynutzung in allen Schulen mit der Möglichkeit genau definierter Ausnahmeregelungen an den weiterführenden Schulen.
"Wir haben in Hessen schnell gehandelt, weil es keine Zeit zu verlieren gibt, und setzen damit deutschlandweit Maßstäbe", sagte Schwarz, der zuvor über Monate zu den Wortführern in der Debatte auf Bundesebene gehört hatte. So "beenden wir eine andauernde Diskussion, schützen die Gesundheit unserer Kinder und fördern die Konzentration und das soziale Miteinander im Schulalltag."
Es gebe bereits in verschiedenen Bundesländern Gesetze, Leitfäden und Erlasse, kommentierte demgegenüber Prien. "Die Schwerpunkte werden in den einzelnen Ländern etwas unterschiedlich gesetzt. Das ist aber auch in Ordnung." Wichtig sei, dass die Debatte stattfinde, auch unter Einbeziehung der Eltern. Direkt nach ihrem Amtsantritt im Mai hatte Prien die Einrichtung einer wissenschaftlichen Expertenkommission zur Handynutzung angekündigt, die alle Lebensbereiche umfassen soll.
"Das Smartphone im Bett und auf dem Nachttisch der Kinder und jüngeren Jugendlichen ist eine mindestens so wichtige Frage wie dessen private Nutzung in der Schule", sagte sie jetzt. Kinder seien online Gewalt, Pornografie, Extremismus bis hin zum Cyber-Grooming ausgesetzt, es gehe um Medienerziehung, Medienschutz und die Regulierung sozialer Medien. Die Mitglieder der Kommission werde sie bis zur Sommerpause bekanntgeben, die Ergebnisse sollen Anfang kommenden Jahres vorliegen, "und dann braucht es eine Strategie".
Die Länder sollen bei der Kommission zwar mit einbezogen werden, trotzdem wäre es spannend zu erfahren, wie die Mitglieder der bestehenden Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz das neue Gremium sehen.
Zentrale Themen des Bildungsminister-Treffens in Mecklenburg-Vorpommern waren auch Gedenkstättenarbeit und Demokratiebildung an den Schulen. Auf dem Programm stand ein gemeinsamer Besuch der Minister in der Mahn- und Gedenkstätte Wöbelin.
Der Nachrichtenagentur dpa sagte Oldenburg, nach ihrer Meinung zeige die Zusammenarbeit der Gedenkstätte mit der Schule dort "auf beeindruckende Weise, wie jüngere Schülerinnen und Schüler altersangemessen an dieses Kapitel unserer Geschichte herangeführt werden, das uns dazu verpflichtet, diese schrecklichen Ereignisse nicht zu vergessen".
Karin Prien sagte, am Ende gehe es darum, "dass Jugendliche Empathie lernen". Ohne Empathie sei man nicht in der Lage, die Dimension von Entrechtung, Diskriminierung und Verfolgung zu erfassen. "Das ist eine große Aufgabe in der heutigen Zeit für unsere Schulen." Der Bund werde in Zukunft weitere Gelder für die Gedenkstättenarbeit im außerschulischen Bereich zur Verfügung stellen.
Anlässlich des 35. Jahrestages der Wiedervereinigung soll bis September eine Erklärung erarbeitet werden, beschloss die BMK, ein Aufruf an die Schulen, „sich intensiv mit der Geschichte der Wiedervereinigung auseinanderzusetzen und die Bedeutung von Demokratie, Freiheit und Frieden zu vermitteln“.
Kommentare
#1 - Name des Hessischen Ministers für Kultus, Bildung und Chancen
Ein kleiner Hinweis zu dem o.a. Artikel:
Der Name des Hessischen Ministers für Kultus, Bildung und Chancen lautet Armin Schwarz, nicht - wie im Artikel angeführt - Armin Schuster.
Mitglied seit
1 Jahr#1.1 - Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank für den Hinweis, der Fehler ist korrigiert. Ich bitte um Entschuldigung!
Ihr Jan-Martin Wiarda


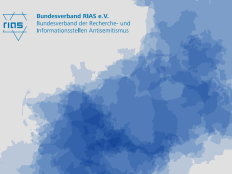





Neuen Kommentar hinzufügen