Was wächst, was stagniert – und wer hoffen muss
Der Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2025 zeigt, wohin die Reise geht: Verteidigung und Soziales wachsen rasant – Bildung und Forschung müssen vor allem auf Sondervermögen setzen.

Bild: Alex Barley / Pixabay.
DAS JAHR IST HALB HERUM, und das Bundeskabinett beschließt den Haushaltsentwurf für 2025. Die Hintergründe, warum das so ist, vom Bruch der Ampelkoalition mitten in der Haushaltsaufstellung über die schwarz-roten Koalitionsverhandlungen und die Einigung auf die Sondervermögen bis hin zum Start der neuen Bundesregierung: alles bekannt. Trotzdem hilft es, vor der Betrachtung des erstmals von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) präsentierten Pakets sich noch einmal seine historisch einzigartige Genese bewusst zu machen.
Historisch – und atemberaubend – sind auch die politischen Verschiebungen, die sich auf den dreieinhalbtausend Seiten voller Zahlen, Tabellen und Erläuterungstexten abbilden. Kurz gesagt: Es gibt nur zwei Ressorts, die in den kommenden Jahren massiv wachsen werden.
Vier BMFTR-Budgets mehr für die Verteidigung
Ja, das Verkehrsministerium, schrieb der Spiegel am Dienstagnachmittag zurecht, kann dieses Jahr deutlich zulegen, um im nächsten Jahr wieder Federn zu lassen. Bis 2029 durchgehend nach oben entwickeln sich aber nur die Einzelpläne des Arbeitsministeriums (+29,2 Milliarden innerhalb von vier Jahren) und des Verteidigungsministeriums (festhalten: +90,4 Milliarden zwischen 2025 und 2029). Ein Gesprächspartner sagte mir am Dienstagnachmittag ein wenig ungläubig: Allein der Zuwachs des Verteidigungsetats entspreche dem Jahresbudget von vier BMFTRs. Das stimmt.
Die Alterung der Gesellschaft plus Wahlgeschenke wie die Mütterrente und die von den Babyboomern begeistert in Anspruch genommene Rente mit 63 treiben die Sozialausgaben, die deutsche Verteidigungswende die Militärausgaben.
Wenn man dann noch einrechnet, dass Medienberichten zufolge die Haushaltsplanung für die nächsten Jahre trotz der Sondervermögen eine strukturelle Unterdeckung in dreistelliger Milliardenhöhe hat, kann einem um sämtliche andere Politikfelder samt zugehöriger Ministerien nur angst und bange werden. Klingbeil betonte bei der Vorstellung seines Entwurfs, die Koalition lege nur 49 Tage nach Amtsantritt "einen gut durchgerechneten, soliden Haushalt 2025 vor". Zugleich muss man sich die Frage stellen, wieviel von der mittelfristigen Finanzplanung in ein paar Monaten oder Jahren schon wieder Makulatur sein wird.
Nun der Blick auf Bildung und Forschung und ihren Stellenwert in dem beschriebenen Umfeld. Der Regierungsentwurf gibt die Budgets der Ministerien noch nach ihrer alten Zusammensetzung an. Soll heißen: Das, was zum Beispiel als Haushalt des BMFTR gelabelt ist, ist in Wirklichkeit der Einzelplan 30 des früheren BMBF, inklusive Bildung, aber dafür ohne alle Bereiche, die aus dem Bundeswirtschaftsministerium hinzukommen sollen.
Das Finanzministerium verweist auf die noch nicht vollzogenen Umstrukturierungen, die laut sogenanntem Organisationserlass bis 1. August umgesetzt werden müssen, und kündigt an, budgetär würden diese erst anschließend im Bundeshaushaltsplan nachvollzogen – und somit "überwiegend" erst im Haushalt für 2026.
Ein letztes Mal der alte Einzelplan
Will man anschauen, was die zuständigen Ministerinnen für ihr neu zugeschnittenes Ressort herausgeholt haben, muss man daher tiefer und in unterschiedlichen Einzelplänen graben. Und in den neuen Sondervermögen erst recht. Dazu gleich.
Grundsätzlich aber, das zeigt der Blick auf den Einzelplan 30, bleibt die Finanzierung von Bildung und Forschung in diesem und in den kommenden Jahren auf dem Niveau, das schon bislang in der mittelfristigen Finanzplanung stand. Dabei hatte gerade erst die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) in einer aktuellen Stellungnahme gemahnt, das bisherige Budget in Höhe von rund 22 Milliarden Euro werde nicht ausreichen, "um dem neuen Aufgabenspektrum und den neuen Priorisierungen gerecht zu werden. Unbedingt vermieden werden muss, dass die zusätzlichen Aufgaben aus den ohnehin seit Jahren schrumpfenden freien Mitteln finanziert werden."
Konkreter: Das alte BMBF konnte vergangenes Jahr 21,7 Milliarden Euro ausgeben, für dieses Jahr waren 22,3 Milliarden angesetzt. Laut Regierungsentwurf bleibt der Einzelplan für dieses Jahr mit 22,4 Milliarden praktisch unverändert. In den Folgejahren war in der alten mittelfristigen Finanzplanung eine Absenkung auf 21,0 Milliarden im Jahr 2028 vorgesehen, im neuen Regierungsentwurf ebenso.
Der einzige Unterschied: 2026 soll es 400 Millionen weniger geben als zuvor geplant, 2027 100 Millionen. Verschiebungen in der Größenordnung kann man getrost ignorieren, aber die Kernerkenntnis lautet: Von einer zusätzlichen Priorisierung der bisherigen Aufgaben des BMBF im Bereich Bildung und Forschung keine Spur. Zumindest nicht im regulären Haushalt. Und wenn man die anderen Einzelpläne und die Sondervermögen einbezieht? Schon eher.
Forschungspolitische Ambitionen, forschungspolitische Spielräume
Starten wir beim Blick in die Details mit einigen Haushaltstiteln, für die künftig Dorothee Bär (CSU) in ihrem neuen Ministerium für Forschung, Innovation und Raumfahrt zuständig sein wird.
• Für das im Koalitionsvertrag an allererster Stelle im Forschungskapitel angekündigte Tausend-Köpfe-Programm zur Gewinnung internationaler Wissenschaftler sind dieses Jahr 27 Millionen Euro vorgesehen. Und in den Folgejahren? "Die Bundesregierung ist gewillt, mit einem entsprechenden Konzept auch weitere Schritte zur Umsetzung in den anschließenden Jahren folgen zu lassen, die dieses Vorhaben weiter vorantreiben", steht im Regierungsentwurf. Aber auch dann sind pro Jahr nur 50 Millionen eingeplant, von denen, was sinnvoll ist, ein großer Teil wiederum in bestehende Programme von DAAD und Humboldt-Stiftung fließen dürfte. Deren durch das Auswärtige Amt verantwortete Grundfinanzierung übrigens gegenüber 2024 zurückgehen soll (beim DAAD um sieben Millionen auf dann 208 Millionen, bei der AvH um 1,3 auf 54,6 Millionen), immerhin etwas geringere Abstriche als noch von der alten Regierung geplant. Indes: Hatte der gar nicht für Forschung zuständige Kulturstaatsminister Wolfram Weimer der Harvard-Universität nicht neulich erst einen Exilcampus angeboten? Ein Vorschlag, zu dem sich Bär wohlweislich übrigens nie öffentlich geäußert hat. Zu Recht: Die in Teilen großspurige wissenschaftspolitische Debatte über die spezielle Anwerbung von US-"Spitzenforschern" erscheint immer stärker als Karikatur ihrer selbst.
• Bärs Ministerium erhält die Zuständigkeiten für Raumfahrt aus dem Wirtschaftsministerium. In dessen Einzelplan stehen sie derzeit noch – für 2025 rund 2,3 Milliarden Euro. Sämtliche Posten sind Copy & Paste im Vergleich zum ersten Regierungsentwurf für den Haushalt 2025, den die alte Koalition im August 2024 vorgelegt hatte. Wo ist der versprochene Aufbruch? Bislang nur im Sondervermögen "Infrastruktur und Klimaneutralität" erkennbar: 23 Millionen für "Investitionen in nationale Raumfahrtstrukturen" in diesem Jahr, weitere 23 Millionen bis 2028. Zusätzlich versprechen die Haushälter 100 Millionen als "Globale Mehrausgabe" für Raumfahrt im Jahr 2027, anwachsend auf 200 Millionen im Jahr 2028 und 300 Millionen 2029. Was auch immer das haushalterisch bedeutet. Alles in allem nicht schlecht. Nur: Was Dorothee Bär bislang zum neuen Schwerpunkt ihres Ministeriums gesagt hat, klingt deutlich ambitionierter als die Zuwächse, die aktuell im Haushalt stehen. Aber hier gilt wie bei allen anderen Posten: Vielleicht versteckt sich noch einiges mehr in den Sondervermögen und Fonds. Oder es wird dann bei den Haushaltsverhandlungen für 2026 etwas. Denn die werden noch deutlich mehr über das Verhandlungsgeschick der neuen Minister und Ministerinnen zeigen.
• Für die im Koalitionsvertrag auf mehreren Seiten beschriebene neue Hightech-Agenda Deutschland sind im Sondervermögen-Entwurf für dieses Jahr 72 Millionen Euro vorgesehen (für den "Aufbau von Infrastrukturen"), in den folgenden vier Jahren weitere 291 Millionen an Verpflichtungsermächtigungen. Auch das auf den ersten Blick erstaunlich wenig, aber dann wiederum wenig überraschend. Denn ob AI-Gigafactory, neue Quantenhöchstleistungsrechner oder der vieldiskutierte Hyperloop-Referenzstrecke: Vorhaben dieser Größenordnung brauchen Planung und Vorlauf, bevor sie finanzwirksam in Haushalten auftauchen. Ministerin Bär, siehe unten, rechnet ohnehin anders – und verweist auf den in der Bundesregierung vereinbarten "Finanzkorridor" für die gesamte Legislaturperiode. Demzufolge erhält ihr Ressort 6,4 Milliarden aus dem Sondervermögen und davon allein 5,5 Milliarden für die Hightech-Agenda.
• Eine drastische Erhöhung hat sie bei der Förderung der Computerspiele-Entwicklung erreicht (auch das Gaming-Referat wandert aus dem Wirtschaftsministerium zu ihr): Im Regierungsentwurf für 2024 waren im regulären Haushalt 51 Millionen für dieses Jahr vorgesehen – jetzt sollen es 88 Millionen werden, und in den Folgejahren sollen es jeweils sogar 125 Millionen werden. Die Branche feiert.
• Die im Koalitionsvertrag angekündigte Schnellbauinitiative für die Hochschulen sucht man im 2025er Haushaltsentwurf vergeblich. 2026, so ist zu hoffen, wird das anders sein – egal, ob in Bärs Haushalt oder anderswo, etwa im Einzelplan des Bauministeriums.
• Ob Bär auch die Zuständigkeit für die großen Innovationsförderprogramme des Wirtschaftsministeriums erhält, ist weiter offen. Derzeitige Einschätzung: eher nicht. Die Budgets für ZIM (519 Millionen), IGF und Inno-Kom (zusammen 253 Millionen) sollen jedenfalls 2025 genau auf dem Level verharren wie schon im ersten Regierungsentwurf geplant.
Dorothee Bär: Wir wissen um die Stellschrauben
Dorothee Bär betont, der erste Haushalt des BMFTR für diese Legislaturperiode zeige: "Wir wissen um die wichtigen Stellschrauben, die den nun notwendigen Fortschritt versprechen." Trotz der angespannten Haushaltslage sei es gelungen, in den Haushaltsverhandlungen bei den drei Säulen Kernhaushalt, Sondervermögen und Klima- und Transformationsfonds (KTF) erfolgreich zu sein. "Wir erhöhen den Kernhaushalt (Plafonds) um über eine Milliarde Euro brutto in dieser Legislaturperiode (600 Millionen Euro Raumfahrt, 227 Millionen Euro für 1000 Köpfe plus, 250 Millionen Euro für Games)."
Zudem habe man die globale Minderausgabe um 250 Millionen Euro jährlich reduziert, das schaffe weiteren Spielraum im Haushaltsvollzug. "Außerdem haben wir 6,4 Milliarden Euro für BMFTR-Forschung und Entwicklung im Sondervermögen festmachen können – davon 5,5 Milliarden für die High-Tech Agenda. Wir sehen 4,3 Milliarden Euro für Energieforschung im KTF bis 2029 vor, obwohl die ursprünglichen Förderlinien des BMFTR dort bisher auslaufen sollten."
In den nächsten Haushalten sollten diese Beträge dann sukzessive auftauchen und greifbarer werden. Apropos greifbar: Der Haushalt 2026 muss an vielen Stellen mehr Übersichtlichkeit schaffen als der Übergangshaushalt 2025. Und apropos Übersichtlichkeit: Das mit der von Bär angeführten geringeren globalen Minderausgabe um eine Viertelmilliarde pro Jahr wäre eine eingehendere Betrachtung wert – enthält der Einzelplan 30 doch in sehr ähnlicher Höhe sogenannte "Umschichtungen in den KTF", was ein bisschen nach Tricks aus dem Finanzministerium riecht.
Prien und die 6,5 Milliarden
Und wie schlägt sich Karin Prien (CDU)? Ihr Ministerium mit den vielen Zuständigkeiten Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend soll für seine bisherigen Haushaltstitel 2025 ebenfalls in etwa so viel erhalten wie bislang geplant: 14,2 Milliarden. Zwischen 2026 und 2027 oszilliert dann der Ansatz zwischen 14,7 und 14,8 Milliarden.
Hinzu kommt künftig dann der Bildungsanteil aus dem früheren BMBF. Für diesen, so das Finanzministerium – "insb. für das Startchancen-Programm, für die Maßnahmen zur Stärkung des Lernens im Lebenslauf und die Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung" – hätten sich im Vergleich zum ersten Regierungsentwurf "keine Änderungen ergeben".
Die Musik spielt allerdings auch hier im Sondervermögen Infrastruktur. 6,5 Milliarden Euro sollen daraus in den nächsten Jahren für "Investitionen in die Kindertagesbetreuung und digitale Bildung" fließen, teilt Klingbeils Ministerium mit, das ist wieder der besagte "Finanzkorridor". Vier Milliarden ins "Investitionsprogramm Kindertagesbetreuung" und wie geplant 2,5 Milliarden in den geplanten Digitalpakt 2.0 – womit auch klar ist, dass die Forderung der Länder an den Bund, seinen Anteil nochmal aufzustocken, auf wenig Gegenliebe gestoßen ist. Für den alten Digitalpakt stehen im regulären Haushalt übrigens immer noch 1,6 Milliarden zum Abfluss an die Länder drin.
Sind diese 6,5 Milliarden nun viel oder wenig? Der Philologenverband sprach in einer ersten Reaktion von einer "Enttäuschung", der Haushaltsentwurf setze "keine klaren Akzente für Bildungsausgaben, Schulbausanierung oder einen auskömmlichen Digitalpakt 2.0".
Botschaft an die Landesbildungsminister
Prien sieht das anders. "Dass allein der Bund aus der ersten Tranche des Sondervermögens für Infrastruktur 6,5 Milliarden Euro zusätzlich in Bildung und Betreuung investiert, ist ein bemerkenswert gutes Ergebnis." Für Bildung seien in erster Linie die Länder zuständig, aber es sei richtig, in Schlüsselbereichen zu unterstützen.
Aus den nächsten Tranchen aus dem Sondervermögen, sprich: in der nächsten Legislaturperiode, müsse der Bund weitere Milliarden aktivieren, fügt Prien hinzu. "Zugleich ist nun meine Hoffnung und Erwartung an die Länder, dass sie ihrerseits möglichst viel aus ihrem Anteil am Sondervermögen, immerhin 100 Milliarden Euro, für Investitionen in Bildungsinfrastruktur ausgeben. Mehr noch: Die Länder haben durch die Änderung der Schuldenbremse zusätzliche Haushaltsspielräume erhalten, diese sollten sie prioritär auch für Kitas und Schulen ausgeben."
Eine klare Botschaft der früheren Bildungsministerin von Schleswig-Holstein in Richtung ihrer früheren Kolleginnen und Kollegen, die sie am Donnerstag bei der Bildungsministerkonferenz treffen wird. Wobei genau genommen laut Vorschlag des Bundesfinanzministeriums nur 40 Milliarden aus dem Sondervermögen an die Länder und 60 Milliarden direkt an die Kommunen gehen sollen.
Das Handelsblatt berichtete am Dienstag außerdem, der Bund habe sich bereiterklärt, zum Ausgleich von Steuerausfällen den Ländern zwischen 2026 und 2029 pro Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich über ein neues Förderprogramm zweckgebunden für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur zu überweisen. Ob diese jährliche Milliarde in den 6,5 Milliarden aus dem Sondervermögen enthalten sind oder tatsächlich noch obendrauf kommen sollen, ließ sich zunächst nicht klären.
Im gleichen Zeitraum bis 2029 will der Bund übrigens allein rund 70 Milliarden aus dem Sondervermögen für das Schienennetz ausgeben.
Der Regierungsentwurf geht jetzt in die parlamentarischen Haushaltsberatungen, und beim Haushalt gilt das "Strucksche Gesetz" mehr als irgendwo sonst: Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es hereingekommen ist. Und die Zeit ist knapp: Für Anfang September ist die Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss geplant, wenn alles final festgezurrt wird. Dann soll Klingbeil auch schon den Regierungsentwurf für 2026 vorlegen. So wirkt der Haushaltsvorschlag der Bundesregierung für 2025 insgesamt mehr wie der Prolog zum Haushalt 2026. Der die richtige Sortierung der Ministerienbudgets und mehr Klarheit bei der Verwendung des Sondervermögens schaffen sollte. Bär und Prien, so steht zu erwarten, werden bis dahin hart weiterverhandeln für ihre Ressorts. Müssen sie auch.
Noch ein persönlicher Kommentar am Schluss:
Ich halte mich für einen halbwegs intelligenten Menschen, doch durch die Logik der Haushaltsaufstellung durchzusteigen, wird zunehmend schwierig. Das liegt gar nicht so sehr daran, dass die Einzelpläne noch nicht die neuen Ministeriumszuschnitte widerspiegeln, sondern vielmehr an dem Dickicht der Sondervermögen und Fonds, der alten wie der neuen. Ist hier noch irgendwo ein Titel versteckt, der für Bildung und Forschung relevant ist, oder dort? Und wie soll man all die verteilten Beträge am Ende seriös zu einem Großen und Ganzen zusammenrechnen?
Selbst die zuständigen Ministerien sind gelegentlich mit den Antworten überfordert. Zumal sich offenbar nicht alles, was politisch zuletzt vereinbart wurde in Sachen Sondervermögen, bereits in dem Entwurf wiederfindet. Neben der Schwierigkeit für einen Journalisten, daraus eine belastbare Analyse zu erstellen, sehe ich vor allem ein demokratietheoretisches Problem, denn die Transparenz leidet genauso für die Abgeordneten im Parlament, die am Ende über all die Ausgaben entscheiden sollen. Wofür ihnen dieses Mal besonders wenig Zeit bleibt.
Kommentare
#1 - Hochschulbau
"Denn ob AI-Gigafactory, neue Quantenhöchstleistungsrechner oder der vieldiskutierte Hyperloop-Referenzstrecke: Vorhaben dieser Größenordnung brauchen Planung und Vorlauf, bevor sie finanzwirksam in Haushalten auftauchen." Dies gilt genauso für den Hochschulbau, der bisher nicht eingepreist ist. Alleine das Verfahren, wer begünstigt werden sollte (vgl. Hochschulbau-Verfahren beim Wissenschaftsrat) wird sicherlich ein Jahr dauern. Finanzwirksam wird es dann selbst 2026 ggf kaum.

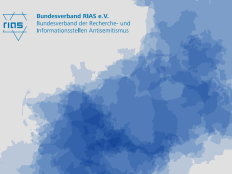






Neuen Kommentar hinzufügen