"Dafür bräuchte es eine Grundgesetzänderung"
Den Digitalpakt Schule auf Dauer? Kann sich Karin Prien vorstellen – gegen mehr Mitspracherechte des Bundes. Ein Interview mit der Bundesbildungsministerin über die Zukunft der Bund-Länder-Kooperation, den Umbau ihres Ministeriums – und was sie aus Kanada mitgenommen hat.

Karin Prien, 60, ist stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und seit Mai 2025 Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Foto: Jesco Denzel/BMBFSFJ.
Frau Prien, der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD) sieht die Digitalisierung in den Schulen als gemeinsame Daueraufgabe von Bund und Ländern und fordert eine Verstetigung des Digitalpakts. "In den Gesprächen auf der Bildungsministerkonferenz auch mit Bundesministerin Karin Prien hat sich gezeigt, dass es da durchaus eine große Offenheit für diese Verstetigung gibt", sagt Teuber gegenüber Table Media. Bestätigen Sie für sich persönlich diese "große Offenheit"?
Es ist kein Zustand, dass man immer wieder in langwierige Verhandlungen gehen muss, die zu Verunsicherung und fehlender Planungssicherheit führen – wie zuletzt zwischen Digitalpakt I und II. Das darf nicht nochmal passieren. Man muss das Thema aber im Gesamtkontext betrachten. Durch die Lockerung der Schuldenbremse und die beiden Sondervermögen hat sich die Situation deutlich verändert.
Was folgt daraus?
Daraus folgt, dass wir im Rahmen der geplanten Kommission zu den Bund-Länder-Finanzen auch über die Digitalisierung in den Schulen sprechen werden. Ich sehe da im Grunde zwei Optionen: Die Länder haben allein durch die Änderungen bei der Schuldenbremse 15 Milliarden zusätzlich pro Jahr. Damit sind sie künftig in der Lage, ihre verfassungsrechtlichen Aufgaben eigenständig zu stemmen. Dazu gehört, gemeinsam mit den Kommunen, die Digitalisierung in den Schulen. Alternativ erklärt man die Digitalisierung zur gemeinsamen Aufgabe von Bund und Ländern. Das ginge aber nur mit einer anderen verfassungsrechtlichen Grundlage.
"Was wir auf jeden Fall brauchen in der Bildungspolitik, ist
eine stärkere und strategischere Zusammenarbeit der Länder
untereinander, inklusive gemeinsam vereinbarter Ziele."
Wenn man Ihre Äußerungen in den vergangenen Tagen und Wochen richtig interpretiert, tendieren Sie zu Option zwei.
Was wir auf jeden Fall brauchen in der Bildungspolitik, ist eine stärkere und strategischere Zusammenarbeit der Länder untereinander, inklusive gemeinsam vereinbarter Ziele. In diesem Zusammenhang, finde ich, kann man sehr wohl diskutieren, ob auch der Bund mehr Verantwortung übernehmen sollte, und das auf Dauer. Dann bräuchte er aber auch mehr Mitspracherechte. Und für beides, für die gemeinsame Finanzierung und die Mitspracherechte in der digitalen Bildung, bräuchte es eine Grundgesetzänderung.
Als Sie noch Landesministerin waren, haben Sie selbst für eine nahtlose Anschlussfinanzierung zwischen Digitalpakt I und Digitalpakt II plädiert. Laut aktueller Haushaltsplanung des Bundes soll es jetzt aber erst 2026 losgehen mit Digitalpakt II. Wie passt das zusammen?
Ich habe bei der Sitzung mit den Bildungsministerinnen und Bildungsministern gesagt: Selbstverständlich können wir über einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn sprechen. Dann kann sehr schnell Planungssicherheit entstehen.
Das heißt, wenn die Bildungsminister fordern, den Start rückwirkend zum 1. Januar 2025 zu vereinbaren, ist das für Sie dasselbe wie ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn?
So ist es. Wir nehmen jetzt unverzüglich die Verhandlungen auf und können uns hierzu sehr schnell einigen.
Überraschend war, dass Sie den 2,5 Milliarden Bundesanteil jetzt innerhalb von vier Jahren auszahlen wollen anstatt wie zwischen Ihrem Vorgänger Cem Özdemir und den Bildungsministerinnen und Bildungsministern der Länder, als auch Ihnen, verabredet, über sechs. Warum?
Man muss sehen: Die 2,5 Milliarden Euro entsprechen nominal dem Bundesanteil am Digitalpakt I im Jahr 2019. Wenn man die Geldentwertung berücksichtigt, sieht das anders aus. Insofern gibt es gute Argumente für die kürzere Laufzeit, um pro Jahr auf eine vergleichbare Finanzkraft zu kommen. Aber auch darüber kann man reden. Vielleicht sagen die Länder ja, dass sie in weiten Teilen nur noch die Nachbeschaffung von Technik finanzieren wollen – und dafür gar nicht so viel Geld pro Jahr benötigen.
Um noch einmal den rheinland-pfälzischen Minister Teuber zu zitieren: Der fürchtet laut Table Media, "dass der Bund eine kürzere Laufzeit will, um die zweite Hälfte der Verabredung auf die nächste Legislaturperiode zu schieben".
Welche zweite Hälfte der Verabredung? Die kenne ich nicht. Diese Aussage kann ich nicht einordnen.
Sie haben nach dem Kabinettsbeschluss zum Haushalt 2025 vergangene Woche hervorgehoben, dass 6,5 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur in Bildung und Betreuung fließen sollen, davon 2,5 Milliarden in den Digitalpakt II. Rund 70 Milliarden gehen in die Bahnsanierung. Zehnmal so viel für die Bahn wie für die Kinder: Stimmen da die politischen Prioritäten?
Das ist eine Milchmädchenrechnung. Die Länder bekommen, wie erwähnt. dank Änderung der Schuldenbremse jährlich 15 Milliarden zusätzlich – auch für die Bildung. Diese Beträge müssen Sie dazurechnen. Außerdem stehen die 100 Milliarden im Sondervermögen, die für die Länder und Kommunen reserviert sind, ebenfalls für Bildungs- und Betreuungsaufgaben zur Verfügung. Es ist ja nicht so, dass die Länder umgekehrt vergleichbare Summen für die Bahn bereitstellen müssten. Man muss das Ganze auch hier im Zusammenhang sehen.
Gleichzeitig gibt es im regulären Haushalt des bisherigen Familienministeriums Kürzungen: zum Beispiel zwei Prozent in der Kinder- und Jugendpolitik, elf Prozent beim Bundesfreiwilligendienst und sogar 12 Prozent ausgerechnet beim Titel "Stärkung der Zivilgesellschaft". Hat letzteres etwas mit der parlamentarischen Anfrage der Union zur staatlichen Unterstützung von NGOs kurz vor der Bundestagswahl zu tun?
Sie vergleichen hier unterschiedliche Verhandlungsstände: den Regierungsentwurf 2025 mit dem vom Parlament verabschiedeten Haushalt 2024. Es liegt in der Entscheidungskompetenz des Parlaments im Haushalt 2025 Änderungen vorzunehmen, wie das auch in den parlamentarischen Beratungen für den Haushalt 2024 geschehen ist. Der Regierungsentwurf 2025 ist deshalb nicht mit dem endgültigen Haushalt 2024 vergleichbar. Innerhalb der Bundesregierung haben wir eine verbindliche Finanzplanung. Gegenüber der Mittelfristigen Finanzplanung haben wir im Vergleich eine deutliche Steigerung in all den genannten Bereichen von 121,5 Millionen Euro. Es bleibt bei den knapp 200 Millionen Euro für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, und die parlamentarische Anfrage hat bei der Haushaltsaufstellung überhaupt keine Rolle gespielt.
"Wir müssen immer den Nachweis liefern, dass das,
was wir tun, Wirkung entfaltet – bei den Bürgerinnen und Bürgern,
bei den jungen Leuten, in den Schulen."
Sie befinden sich mitten im Umbau Ihres Ministeriums. Die Zuständigkeiten für Bildung kommen aus dem bisherigen BMBF, dafür wollen Sie bei sich im Haus gleich zwei Bildungsabteilungen einrichten. Wann werden Sie die fertige Gesamtstruktur des neuen BMBFSFJ offiziell präsentieren?
Der Organisationserlass der Bundesregierung gibt vor, dass der Umbau bis zum 1. August abgeschlossen sein muss – und das werden wir auch schaffen. Wir sind in den letzten Zügen. Nächste Woche gibt es noch eine Leitungsklausur mit allen bisherigen Abteilungen und wichtigen Akteuren aus dem ehemaligen BMBF, auch die Personalräte sind eingebunden. Auf der Personalversammlung im Ministerium habe ich neulich skizziert, dass wir eine Abteilung für allgemeine Bildung sowie Bildungsforschung und eine für berufliche Bildung und lebenslanges Lernen haben werden. Hinzu kommt eine neue Grundsatzabteilung, die sich mit den Schnittstellen aller Bereiche beschäftigen und dafür sorgen wird, dass das Ministerium eine kohärente Gesamtstrategie hat.
Auf der Personalversammlung haben Sie betont, dass es für Ihr Ministerium gelte, "immer wieder die Sinnhaftigkeit unseres Handelns nachzuweisen". Was genau meinten Sie damit?
Ich meinte "sinnhaft" im Sinne von John Hattie: wirksam. Wir müssen immer den Nachweis liefern, dass das, was wir tun, Wirkung entfaltet – bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den jungen Leuten, in den Schulen. Ein Aha-Moment war für mich, als ich mit anderen Landesbildungsministern in Kanada war. Der Bildungsminister von Alberta fragte uns, wie wir in Deutschland eigentlich messen, ob unsere bildungspolitischen Maßnahmen in Schulen und Unterricht ankommen – und wie wir unsere Ausgaben gegenüber den Steuerzahlern rechtfertigen. Ich fand, das war eine ziemlich gute Frage.
Und Ihre Antwort?
Wir hatten keine gute. Aber wir müssen zu einer kommen. Natürlich müssen wir Neues ausprobieren dürfen – aber entscheidend ist für mich auch als ehemalige Landesministerin: Kommt es bei den Schülerinnen und Schülern an? Deshalb werde ich dafür sorgen, dass alle wesentlichen Maßnahmen und Programme meines Ministeriums wissenschaftlich evaluiert werden.
Die neue Hausanordnung, die Sie bei der Personalversammlung vorgestellt haben, enthält auch die Anweisung, dass die interne und externe Kommunikation des Ministeriums von E-Mails über Vermerke bis hin zu Bürgerbriefen und Gesetzesvorlagen ausschließlich nach den Regeln des Rates für deutsche Rechtschreibung erfolgen soll. Was im Umkehrschluss heißt: Kein Gendersternchen oder andere Sonderzeichen mehr.
Wenn Sie in die Hausanordnung schauen, finden Sie darin auch Ausnahmen: Wo es für die Kommunikation mit bestimmten Gruppen notwendig erscheint, können Sonderzeichen weiter verwendet werden. Im Übrigen verstehe ich gar nicht, warum man aus der Erwartung einer Hausleitung, dass einheitlich und entsprechend den Rechtschreibregeln geschrieben wird, ein Aufregerthema macht. Reden kann ohnehin jeder, wie er will. Und dass Vorlagen und Vermerke in einer einheitlichen Form verfasst werden, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich kann gar nicht nachvollziehen, wie man es anders handhaben sollte. Da ist in den letzten Jahren einiges ins Rutschen geraten.



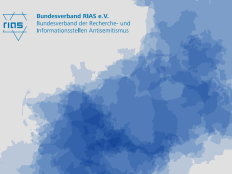




Neuen Kommentar hinzufügen