"Die BMK soll nicht wie ein lahmer Haufen wirken"
Christine Streichert-Clivot und Dorothee Feller koordinieren künftig die Arbeit der Bildungsministerkonferenz – zwischen Föderalismus-Skepsis, Digitalpakt-Verhandlungen und wachsendem Erwartungsdruck. Im Interview sprechen sie über Führungsanspruch, parteiübergreifende Kompromisse und ihre Erwartungen an ihre Ex-Kollegin, die neue Bundesbildungsministerin Karin Prien.

Die SPD-Politikerin Christine Streichert-Clivot (rechts), 45, ist seit 2019 saarländische Ministerin für Bildung und Kultur. 2024 hatte sie das Amt als Präsidentin der Kultusminsterkonferenz inne. Die Christdemokratin Dorothee Feller (links), 59, ist seit 2022 Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Foto Streichert-Clivot: Holger Kiefer, Foto Feller: Klaus Altevogt.
Frau Streichert-Clivot, Frau Feller, in der Bildungsministerkonferenz (BMK) übernehmen Sie künftig eine besondere Rolle als Koordinatorinnen. Sie, Frau Streichert-Clivot, für die sogenannten "A"-Länder mit SPD-Regierungsbeteiligung, und Sie, Frau Feller, für die "B"-Länder, in denen die Unionsparteien Koalitionspartner sind. Gleichzeitig wird das klassische A- und B-Muster aber durch immer buntere Koalitionen auf Länderebene zunehmend aufgeweicht. Hat da die Rolle der Koordinatorinnen überhaupt noch strategisches Gewicht?
Dorothee Feller: Gerade weil die politischen Konstellationen in den Ländern vielfältiger geworden sind, braucht es die Koordinatorinnen mehr denn je. Unsere Aufgabe ist es, innerhalb der politischen Konstellationen gemeinsame Positionen zu formen – und als Ansprechpartnerin für die jeweils andere Seite zu fungieren. Das sorgt für mehr Klarheit und Fokus in der Debatte.
Christine Streichert-Clivot: Hinzu kommt: In einer dynamischen Bildungslandschaft müssen wir schnell und fokussiert reagieren. Die Koordination hilft, Entscheidungen auch jenseits der regulären Sitzungen vorzubereiten. Das ist ein praktischer Beitrag dazu, dass die BMK nicht nur nach außen handlungsfähig erscheint – sondern es tatsächlich ist: im Interesse vor allem der Kinder und Jugendlichen.
Sehen Sie sich dabei nur als Moderatorinnen von Abstimmungen – oder auch als Personen, die Impulse setzen und Richtung geben wollen?
Streichert-Clivot: Beides gehört zusammen. Wir müssen erst einmal zuhören, was in den Ländern gedacht und gebraucht wird – gerade angesichts unterschiedlicher Koalitionskonstellationen. Gleichzeitig besteht unsere Aufgabe auch darin, auf beiden Seiten Verständnis für den übergeordneten Kompromiss zu schaffen. Wir wollen, dass die BMK auch die bundesweit wahrgenommene Bildungspolitik nach vorne bringt und nicht wie ein lahmer Haufen wirkt, sondern schlagkräftig sein – und dafür braucht es beides: Rückbindung und Führung.
Was bedeutet Führung konkret? In dem nur einen Jahr, in dem Ihre Vorgängerinnen die Koordinatorinnenrolle innehatten – Stefanie Hubig für die A- und Karin Prien für die B-Seite – sind die beiden ein paar Mal mit Initiativen vorgeprescht, die nicht von allen Bildungsminister-Kolleginnen nur mit Freude aufgenommen worden sind. Werden Sie die BMK auch so fordern?
Feller: Was nach außen manchmal wie ein Vorpreschen wirkte, war oft abgestimmt – oder spiegelte Diskussionen innerhalb der BMK wider. Als Koordinatorin werde ich fokussieren, nicht polarisieren. Diskussionen sind wichtig, sie schärfen Positionen. Aber am Ende muss ein tragfähiger Beschluss stehen. Das ist mein Anspruch.
"Wir dürfen uns nicht durch parteipolitische
Scheingefechte auseinanderdividieren lassen."
Die Bildungsminister stellen öffentlich gern in den Vordergrund, dass es zwischen ihnen gänzlich unideologisch zugehe – was impliziert, das sei früher anders gewesen. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Bildungspolitik von SPD und Union heute kaum noch unterscheidbar ist?
Feller: Unterschiede gibt es sicherlich. Aber im Konferenzalltag erleben wir eine starke Sachorientierung. Wir suchen gemeinsam nach Lösungen – für ganz Deutschland. Der Föderalismus bleibt bestehen, doch wir stimmen uns besser ab, um Verlässlichkeit zu garantieren. Es geht darum, das Verbindende zu stärken, damit wir vorankommen. Uns eint das Ziel, die Bildungsqualität zu stärken und für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen.
Streichert-Clivot: Wir denken zum Beispiel unterschiedlich bei der Frage, wie wir das Recht auf inklusive Bildung in den Schulen umsetzen. Aber wir stehen bundesweit vor denselben großen Herausforderungen. So darf die soziale Herkunft eines Kindes nicht über dessen Bildungserfolg entscheiden – in Nordrhein-Westfalen ebenso wenig wie im Saarland oder anderswo. Auch der Fachkräftemangel betrifft uns alle. Frau Feller vertritt das größte Bundesland, ich eines der kleineren – das bedeutet andere Strukturen, andere Zugänge. Wir können im Saarland manches direkter steuern, während in Nordrhein-Westfalen viele Ebenen eingebunden sind. Das schafft unterschiedliche Sichtweisen und somit Chancen. Genau das können wir als Koordinatorinnen einbringen. Wir dürfen uns dabei nicht durch parteipolitische Scheingefechte auseinanderdividieren lassen. Die Menschen erwarten zurecht, dass wir uns auf Lösungen konzentrieren – und nur schwer nachvollziehen können, wenn Politik sich in Grabenkämpfen verliert und am Ende nichts Konkretes herauskommt.
Eben war Karin Prien noch Ihre BMK-Kollegin, jetzt ist sie Bundesbildungsministerin. Welche Erwartungen verbinden Sie mit ihr?
Streichert-Clivot: Ich habe hohe Erwartungen – und bislang erfüllt Karin Prien sie. Der Ton stimmt. Sie hat in ihren ersten Reden klare Prioritäten benannt, etwa beim Ganztag und dem Digitalpakt. Entscheidend ist für mich: Karin Prien kennt die föderalen Strukturen, sie kennt die Länderlogik. Und sie zeigt, dass es ein neues Miteinader zwischen Bund und Ländern braucht. Das war unter Bettina Stark-Watzinger zuletzt leider verloren gegangen – auch wenn ihr Interims-Nachfolger Cem Özdemir sich bereits erfolgreich bemüht hat, die Bund-Länder-Beziehungen wieder in bessere Bahnen zu lenken.
Feller: Karin Prien weiß, wie die Länder ticken. Sie hat als Ministerin noch bis vor ein paar Wochen selbst an BMK-Beschlüssen mitgewirkt – das schafft Vertrauen. Natürlich wird sie auf längere Sicht ihre Rolle als Bundesbildungsministerin unabhängig von ihrer Vergangenheit als Landesministerin definieren, und das ist auch richtig so. Aber erstmal hoffe ich, dass wir die Projekte, die wir bereits mit der Vorgängerregierung angestoßen haben, zügig und möglichst unbürokratisch fortsetzen können.
Der Digitalpakt 2.0 etwa wurde in letzter Minute zwischen Cem Özdemir und der Bildungsministerkonferenz (BMK) grundsätzlich vereinbart – unterschriftsreif ist er allerdings noch nicht. Erwarten Sie, dass Karin Prien hier auf das Sondervermögen zurückgreift und das geplante Volumen von 2,5 Milliarden Euro noch einmal deutlich aufstockt?
Feller: Ich hielte es für schwierig, die Finanzierung noch einmal aufzuschnüren. Denn wenn der Bund mehr Geld hineingibt, stellt sich vermutlich automatisch auch wieder die Frage nach der Kofinanzierung durch die Länder. Und schon das derzeit vereinbarte Volumen ist für viele Länder eine große Herausforderung. Aber eventuell ergeben sich ja noch einmal neue Möglichkeiten über das Sondervermögen. Insofern gilt: Mehr Geld ist natürlich immer gut – aber mindestens genauso wichtig ist, dass es auch praktikabel abrufbar ist. Der Digitalpakt 2.0 sollte ein positives Beispiel für ein schlankes Förderdesign werden. Davon profitieren nicht nur die Länder, sondern auch die Schulträger.
"Die letzte Länderposition – auch unter Beteiligung
von Karin Prien – war klar: Wenn der Bund
'mehr Geld geben will, nehmen wir es gern."
Streichert-Clivot: Die letzte Länderposition – auch unter Beteiligung von Karin Prien – war klar: Wenn der Bund mehr Geld geben will, nehmen wir es gern. Zugleich sehen wir im Sondervermögen, dass ein erheblicher Teil der Mittel an die Kommunen gehen soll. Genau dort möchte ich ansetzen: Bei der Digitalisierung und Modernisierung unserer Schulen gibt es gewaltige Bedarfe auf kommunaler Ebene. Es ist ein wichtiges Signal, dass Bildung im Sondervermögen explizit berücksichtigt wird. Und ich finde es richtig, dass Karin Prien zusätzlich auch finanzielle Mittel für den Kita-Ausbau in Aussicht gestellt hat. Entscheidend wird sein, dass das Geld dort ankommt, wo es wirklich gebraucht wird. Wichtig beim Digitalpakt ist es mir, dass wir bald zu Entscheidungen kommen. Die Kommunen - und damit unsere Schulen - warten seit einem Jahr. Nach fünf Jahren Digitalpakt sind wir an einem Punkt angekommen, an dem Infrastruktur erneuert werden muss. Ich bin aber auch zuversichtlich, dass dies eines der großen Vorhaben Karin Priens in der nächsten Zeit sein wird, so ihre Ankündigungen.
Laut schwarz-rotem Koalitionsvertrag soll das Startchancen-Programm für Schulen auf Kitas ausgeweitet werden. Zudem will Karin Prien bundesweit verpflichtende diagnostische Tests für Vierjährige und eine verbindliche Förderung für Kinder mit Nachholbedarf einführen. Werden die Länder sich auf ein Kita-Startchancen-Programm einlassen?
Streichert-Clivot: Der Kita-Platz ist entscheidend für gelingende Bildungsbiografien. Deutschkompetenz als Voraussetzung für die Erfüllung der Schulpflicht zu sehen, ist nicht mein Ansatz. Wir müssen Kinder entsprechend Fördern. Da bin ich ganz klar: Wir brauchen eine verlässliche Diagnostik und selbstverständlich die Unterstützung bei festgestellten Defiziten – und zwar nicht nur durch die Kitas, die damit womöglich überfordert wären, sondern unter Einbeziehung von Gesundheitsdiensten, etwa durch logopädische Angebote. Auf keinen Fall dürfen die Eltern mit der Sprachförderung allein gelassen werden. Für jede Förderung braucht es die entsprechende Unterstützung im Kindertagesbereich und das Startchancen-Programm kann da sicherlich sehr viel Gutes leisten. Wir müssen aber auch aus der Erfahrung lernen. Der bürokratische Aufwand muss sich für alle im Rahmen halten. Das haben uns die Schulen zurückgemeldet. Auch die Umsetzung von Sprachtest und Sprachförderung darf nicht zu bürokratisch sein. Sonst können die Kitas das nicht leisten.
Feller: Viele Kinder bringen heute nicht mehr die Selbstverständlichkeiten mit in die Schule, die frühere Generationen hatten – sprachlich, motorisch, sozial. Das ist keine Schuldfrage, sondern Realität, auf die wir reagieren müssen. In NRW bereiten wir derzeit ein digitales Sprachdiagnostik-Tool vor. Damit wollen wir bereits bei der Grundschulanmeldung feststellen: Mit welchen Kompetenzen kommt ein Kind? Und wie können wir es bis zum Schulstart gezielt fördern, damit alle mit vergleichbaren Chancen starten? Solche Beiträge können und wollen die Länder leisten. Wichtig ist, dass der Bund bei seinen Initiativen auch das berücksichtigt, was an Instrumenten bereits vorhanden ist.
Ab 2026 soll bundesweit ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler gelten, zunächst für die Erstklässler. Im Hintergrund haben sich Kommunalverbände für eine Verschiebung starkgemacht. Sind die Länder vorbereitet? Und gibt es überhaupt noch einen pädagogischen Anspruch?
Feller: Die Umsetzung zum 1. August 2026 ist für alle Länder und Kommunen eine enorme Herausforderung. Natürlich sind die Voraussetzungen unterschiedlich: In den ostdeutschen Ländern ist der Ganztag historisch stärker verankert. In westdeutschen Ländern wie Nordrhein-Westfalen müssen wir mehr Aufbauarbeit leisten. Bei uns hat sich über Jahre das sogenannte Trägermodell etabliert – das bedeutet: Der Ganztag wird in der Regel von freien Trägern verantwortet, findet aber in den Schulgebäuden statt. Das war eine bewusste Entscheidung, um den Kindern lange Wege zu ersparen. Für die Kommunen ist der Ganztagsausbau vor allem eine personelle Herausforderung. Es fehlt an qualifiziertem Personal. Deshalb haben wir in NRW bewusst keine gesetzlichen Standards vorgegeben, die niemand erfüllen kann, sondern mit einem Erlass Eckpunkte definiert. Uns war wichtig, dass alle frühzeitig wissen, was auf sie zukommt und was möglich ist. Und natürlich geht es auch um Qualität. Ganztagsangebote und Schule dürfen keine Parallelwelten sein. Wichtig deshalb: Wir stecken in NRW erhebliche Lehrkräfteressourcen in den offenen Ganztag. Und: Die Mitarbeitenden in beiden Bereichen – Schule und freie Träger - müssen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das beschreiben wir in unserem Erlass sehr klar.
Streichert-Clivot: Im Saarland verfolgen wir einen zweigleisigen Ansatz. Zum einen unterstützen wir unsere finanziell stark belasteten Kommunen mit einem Schulbauprogramm, damit dringend nötige Investitionen – gerade im Ganztagsbereich – realisiert werden können. Denn das Ganztagsprogramm des Bundes reicht für viele bauliche Maßnahmen nicht aus. Zum anderen haben auch wir einen erheblichen Fachkräftebedarf. Denn im Ganztag wird auf denselben Pool zurückgegriffen wie in der frühkindlichen Bildung – auf Erzieherinnen und Erzieher. Deshalb haben wir im Saarland eine Fachkräfteoffensive gestartet, die alle Phasen der Personalgewinnung in den Blick nimmt, inklusive Wegen für den Quereinstieg.
Was ist aus dem einst nach dem Pisa-Schock beschworenem Ziel geworden, den gebundenen Ganztag zum flächendeckenden Standard zu machen: statt freiwilliger Betreuungsangebote ein für die Schüler verpflichtendes Ganztagsprogramm mit übergreifendem pädagogischem Konzept?
Streichert-Clivot: Für mich ist klar: Die beste Qualität im Ganztag erreichen wir nicht nur durch Strukturdebatten, sondern auch durch gut qualifiziertes Personal. Entscheidend ist, dass Fachkräfte die Angebote tragen. Und genau da wird die Personalgewinnung zur zentralen Herausforderung.
"Nicht alle Eltern wünschen sich,
dass ihr Kind bis 16 Uhr in der Schule bleibt."
Feller: Es lohnt sich, genau hinzuhören – besonders bei den Eltern. Nicht alle wünschen sich, dass ihr Kind bis 15 oder 16 Uhr in der Schule bleibt. Viele sagen uns, sie hätten lieber eine flexible Betreuung über Mittag, um das Abholen individueller gestalten zu können. Gerade in ländlich geprägten Regionen hören wir das häufig. In Ballungsräumen hingegen ist der Wunsch nach einem verbindlicheren Angebot oft stärker ausgeprägt.
Ein anderes emotionales Thema: Karin Prien will die private Handynutzung an Grundschulen verbieten. Für weiterführende Schulen sollen altersgerechte Regeln gelten. Aber auch sie betont: Die Entscheidung liegt bei den Ländern. Wird es eine gemeinsame Linie geben?
Streichert-Clivot: Im Saarland haben wir im Zuge eines neuen Digitale-Bildung-Gesetz, das zum kommenden Schuljahr in Kraft tritt, die Nutzung so, geregelt, dass Handys und Smartwatches in der Grundschule und der Primarstufe der Förderschulen nichts verloren haben. In weiterführenden Schulen braucht es altersangemessene Regeln innerhalb der Schulgemeinschaft. Diese werden von der Schulgemeinschaft selbst mit großer Mitbestimmung aller am Schulleben beteiligten beschlossen.Wichtig ist mir auch: Wir müssen Eltern stärker sensibilisieren – Kinder brauchen Schutz im digitalen Raum.
Feller: In NRW muss jede Schule bis zum Herbst eine eigene Nutzungsordnung vorlegen. Für Grundschulen empfehlen wir, private Geräte außen vor zu lassen. Aber: Es geht nicht um Verbote von oben, sondern um partizipative Lösungen, die von der Schulgemeinschaft getragen werden – auch das ist ein pädagogisches Prinzip. Vor allem befördert das auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Mediennutzung und deren Auswirkung auf das Lernen – bei Schülerinnen und Schülern, aber auch bei Eltern. Und genau das wollen wir ja auch erreichen.
Zwei Länder, zwei Meinungen. Das klingt nicht nach einer bundesweit einheitlichen Regelung.
Feller: Ich weiß gar nicht, ob wir für alles immer einen gemeinsamen Beschluss der BMK brauchen. Alle Länder beschäftigen sich gerade mit dem Thema. Wir haben uns in der BMK intensiv ausgetauscht und gehen jetzt ähnliche Wege in die gleiche Richtung – die einen per Gesetz und als Verpflichtung, die anderen per Erlass und als Empfehlung. Das reicht.
Karin Prien hat in ihrer neuen Rolle gerade das Ziel bekräftigt, bis 2035 die Schulabbrecherquote zu halbieren. Eine Aussage, die zurückgeht auf die gemeinsame Initiative von Prien und Hubig mit der grünen Kultusministerin von Baden-Württemberg, Teresa Schopper, für mehr Verbindlichkeit durch messbare Bildungsziele. Bezeichnenderweise machten die drei ihren Vorstoß Anfang 2025 außerhalb der BMK, moderiert von der Wübben-Bildungsstiftung. Nehmen Sie den Ball der drei als Koordinatorinnen auf?
Feller: Auch diese Initiative der drei war nie völlig losgelöst von unseren Diskussionen in der BMK. Die Reduzierung der Schulabbrecherquote ist zum Beispiel auch Thema bei der Aufstellung des Startchancen-Programms gewesen. Ich glaube, alle Länder können diesen Weg gut mitgehen.
"Bildungspolitik muss sich an ihren Ergebnissen
messen lassen – mir ist davor nicht bange."
Streichert-Clivot: Ich habe die Initiative "Bessere Bildung 2035" von Frau Prien, Frau Hubig und Frau Schopper damals positiv begleitet. Denn wir brauchen nicht nur Programme wie das Startchancen-Programm, sondern auch klarere Ziele und bessere Datengrundlagen. Wir diskutieren regelmäßig Studien wie PISA oder IGLU – aber wir müssen auch in der Lage sein, ihre Ergebnisse systematisch auszuwerten. Wir brauchen eine kontinuierlichere, datenbasierte Analyse dessen, was in unseren Schulen tatsächlich passiert. Und ja: Bildungspolitik muss sich an ihren Ergebnissen messen lassen. Mir ist davor nicht bange – im Gegenteil. Es hilft uns, die Mittel, die wir einsetzen, zielgenauer und wirkungsvoller dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden.
Feller: Es mangelt uns nicht an Erkenntnissen – wir haben schon viele Daten. Entscheidend ist, dass wir daraus auch konkrete Konzepte entwickeln und wirklich besser werden.
Der Aktionsrat Bildung forderte in seinem jüngsten Gutachten deshalb ein Comeback des PISA-Ländervergleichs.
Streichert-Clivot: Nur helfen Rankings allein wenig. Die Unterschiede zwischen den Bildungssystemen der Bundesländer sind groß.
Der Aktionsrat sagt, die Abschaffung des PISA-Bundsländervergleichs 2009 sei "symptomatisch" gewesen "für einen fehlenden Wunsch nach klarer Transparenz der Leistungsentwicklung".
Streichert-Clivot: Nochmal: Wir brauchen nicht nur Daten, sondern auch Empfehlungen und Hinweise, wie wir besser werden. Der Austausch mit der Wissenschaft ist dafür zentral – nicht die Platzierung auf einer Liste.
Feller: Ich schaue lieber auf den IQB-Bildungstrend als auf PISA. Der liefert uns konkretere Hinweise, wo wir ansetzen müssen, um den Bildungserfolg unserer Schülerinnen und Schüler zu verbessern – und vor allem, wo wir gezielt nachsteuern müssen. Die PISA-Studie als internationaler Vergleich sehe ich mir natürlich auch genau an, aber für unsere Arbeit vor Ort ist der Bildungstrend das präzisere Instrument.
Der Bildungsföderalismus steht immer wieder unter Beschuss. In Umfragen sprechen sich regelmäßig klare Mehrheiten für seine Abschaffung aus. Bitte geben Sie zum Schluss ein paar gute Argumente für seine Beibehaltung.
Feller: Wir sind ein großes und vielfältiges Land, und der Bildungsföderalismus erlaubt passgenaue Lösungen vor Ort. Kanada ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch föderale Staaten in internationalen Vergleichen gut abschneiden. Der Föderalismus lebt vom Austausch – und auch vom Wettbewerb. Warum schneiden Hamburgs Schüler im Ländervergleich nun besser ab? Was läuft gut in Baden-Württemberg? Solche Fragen diskutieren wir offen – und da ist "Abschreiben" ausdrücklich erlaubt. Wenn wir unseren Austausch in der BMK mit Transparenz und Benchmarking verbinden, wird Vielfalt zur Stärke – nicht zum Problem.
"Die Vielfalt im Föderalismus ist zur Stärke,
wenn man sie aktiv nutzt."
Aber leistet die BMK dieses Benchmarking?
Feller: Das Bild vom abgeschotteten Bildungsföderalismus trifft doch längst nicht mehr zu. Vielleicht wird das noch nicht überall so wahrgenommen, aber es gibt eine große Bereitschaft, voneinander zu lernen – unabhängig von Parteigrenzen. Genau dafür dienen auch die Strukturreformen, die wir in der Kultusministerkonferenz angestoßen haben: damit dieser offene Austausch nach außen noch sichtbarer wird.
Streichert-Clivot: Für mich ist der Bildungsföderalismus ein demokratisches Prinzip. Vielleicht liegt das auch an meiner Herkunft aus dem Saarland, direkt an der Grenze zu Frankreich. Dort sehe ich, was ein stark zentralistisch organisiertes Bildungssystem bedeutet: Regionale Bedürfnisse geraten schnell aus dem Blick, weil Entscheidungen letztlich immer in Paris fallen. Gleichzeitig braucht es gemeinsame Standards, etwa bei Abschlüssen oder beim Schulwechsel zwischen Ländern. Daran arbeiten wir in der BMK, etwa mit Blick auf Schulabschlüsse oder bei der Aufnahme geflüchteter ukrainischer Schülerinnen und Schüler – da haben wir bewusst eine gemeinsame Linie gefunden. Und wir lernen voneinander: Die BMK ist ein Ideenpool. Die einen sind beim Thema Fachkräfte weiter, die anderen bei der Digitalisierung. Diese Vielfalt ist kein Nachteil – sie ist eine Stärke, wenn man sie aktiv nutzt.
Kommentare
#1 - "Die PISA-Studie als internationaler Vergleich sehe ich mir…
"Die PISA-Studie als internationaler Vergleich sehe ich mir natürlich auch genau an, aber für unsere Arbeit vor Ort ist der Bildungstrend das präzisere Instrument." Ich habe große Zweifel, ob sich Bildungspolitiker und Bildungsjournalisten die PISA-Berichte wirklich ansehen. Mir scheint, jeder pickt sich nur das heraus, was in die jeweilige politische Richtung passt. Nehmen wir doch den Satz "PISA hat gezeigt: In keinem [oder in kaum einem] Industrieland hängt der Bildungserfolg so stark von der sozialen Herkunft ab wie in Deutschland." Die PISA-Macher selbst bestreiten, dass sie diesen Satz in die Welt gesetzt haben. Der eine schreibt ihn jetzt vom anderen ab. Das tatsächliche Ergebnis von PISA 2022 nach der Zusammenfassung in Tabelle 4.1 (Seite 14) hier: https://www.pisa.tum.de/fileadmin/w00bgi/www/ Berichtsbaende_und_Zusammenfassungungen/PISA-2022-zusammenfassung.pdf Beim sozialen Gradienten liegt Deutschland im OECD-Durchschnitt, bei dessen Einfluss um drei Prozentpünktchen ungünstiger, aber die folgenden Länder liegen bei beiden (!) Kennzahlen noch ungünstiger: Österreich, Frankreich, Schweiz, Belgien, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Israel. Und auch Litauen, Polen und Neuseeland liegen bei beiden Kennzahlen ungünstiger als der OECD-Durchschnitt. Speziell bei Frankreich ist das schon seit vielen PISA-Studien so, aber niemand kritisiert es. Immer wird nur Deutschland gescholten -- aus durchsichtigen Motiven. Die o.g. Zahlen bedeuten praktisch, dass auch in Deutschland 81,3 % der Leistungs-unterschiede durch ANDERE Ursachen zu erklären sind als die soziale Herkunft, im OECD-Durchschnitt 84,5 %. Aber niemand redet von diesen anderen Ursachen, niemand zitiert auch nur solche Zahlen. Statt-dessen tut man so, als sei der geringe Unterschied eine Katastrophe.






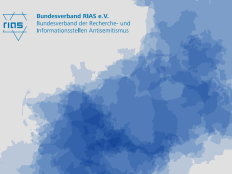

Neuen Kommentar hinzufügen