"Drei-Meter-Straßen führen nicht ans Ziel"
Warum Deutschland seine Forschungsinfrastrukturen strategischer steuern muss – und was passiert, wenn Digitalkonzerne die Lücken füllen. Petra Gehring und Stefan Lange vom Rat für Informationsinfrastrukturen über einen Paradigmenwechsel: weg von Projektitis, hin zu echter Verantwortung.

Petra Gehring ist Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt, leitet das Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung des Landes Hessen und ist Vorsitzende des Rates für Informationsinfrastrukturen (RfII). Stefan Lange ist Leiter der RfII-Geschäftsstelle. Fotos: RfII/Claus Völker.
Der Wissenschaftsrat hat Mitte Juli seine Empfehlungen zur Zukunft der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vorgelegt. Kurz darauf folgte der Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) mit einem eigenen Positionspapier: "Leistung in Verantwortung". Ihr Blick richtet sich auf das gesamte System wissenschaftlicher Informationsinfrastrukturen. Ich würde Ihre Kernbotschaft zusammenfassen mit: "Ownership statt Projektitis". Frau Gehring, trifft das den Kern?
Petra Gehring: Da würden wir uns schon verstanden fühlen. Weder Projektitis noch andere, lediglich verstreute Aufwüchse führen im Bereich digitaler Infrastrukturen weiter. Darum fordern wir einen Paradigmenwechsel – hin zu einer Haltung der Verantwortung. Ownership richtet sich an viele verschiedene Akteure und eröffnet ein Gegenbild zur Welt der Projektlogik. Und bietet vielleicht sogar einen Hinweis darauf, warum wir oft in dieser Logik steckenbleiben.
Wissenschaftliche Informationsinfrastrukturen, das sind Bibliotheken, Software, Hochleistungsrechner, Forschungsdatenzentren, Datenplattformen. Organisiert in einer Vielzahl nebeneinanderstehender Initiativen: NFDI, Nationales Hochleistungsrechnen (NHR), KI-Zentren, Medizininformatik. Die Liste in Ihrem Papier ist noch viel länger. Was fehlt, damit daraus ein in sich stimmiges Gesamtsystem wird?
Gehring: Was sicher fehlt, ist genau das, was Sie angesprochen haben. Wir haben es allerdings mit einer quantitativ wie auch inhaltlich gigantischen, historisch gewachsenen Landschaft zu tun. Ein Nebeneinander – teils auch ein Gegeneinander – von Infrastrukturen. Dass in einem System einer solchen Größenordnung an vielem parallel gewerkelt wird, ist normal. Denn es geht ja um sehr unterschiedliche Dinge, die da entwickelt, beforschbar und nachhaltig verfügbar gemacht werden. Die Bandbreite reicht von der Entwicklung neuer Forschungs- und Datenerhebungsmethoden, also hochspezialisierten Kulturtechniken, bis hin zu riesigen technischen Anlagen mit entsprechendem Energieverbrauch.
Aber diese Heterogenität hat doch einen Preis: enorme Effizienzverluste.
Gehring: Ja, das System ist komplex. Doch diese Heterogenität ist niemandem anzulasten. Sie ist Ausdruck der Vielfalt von Wissenschaft und der Vielfalt der Anforderungen, die wir als Gesellschaft an Wissenschaft stellen. Wir sehen viele agile, krabbelige, manchmal auch schwerfällige Aktivitäten. Und dass dabei niemand den vollen Überblick hat – ich würde sagen: haben kann – ist schlicht ein Faktum.
"Der Gedanke, mithilfe einer Art Masterplan aus alldem
ein vollständig steuerbares Gesamtsystem zu machen, ist unrealistisch.“
Muss das so bleiben?
Gehring: Bis zu einem gewissen Grad: ja. Alles andere überstiege jede menschliche wie maschinelle Planungsintelligenz. Der Gedanke, mithilfe einer Art Masterplan aus alldem ein vollständig steuerbares Gesamtsystem zu machen, ist unrealistisch. So wie man ja auch keinen Markt oder eine Öffentlichkeit zentral steuern kann – oder sollte. Deshalb bin ich vorhin beim Begriff "Gesamtsystem" etwas zusammengezuckt. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir sehr wohl umdenken müssen. Der Fokus kann nicht mehr darauf liegen, immer noch etwas Neues obendrauf zu setzen. Neue Themen, neue Akteure. Das führt zu einer Pulverisierung. Es wird viel Geld investiert, aber oft in kurzfristige Aktivitäten. Wir müssen zu steuern anfangen.
Was heißt das?
Gehring: Steuerbarkeit heißt für mich: Reflexivität. Systeme, die sich selbst beobachten, nachjustieren, strategisch navigieren – im laufenden Prozess. Genau das fehlt uns bislang. Wir haben viele Säulen, Foren, verteilte Zuständigkeiten – aber keine konsolidierte Form, die wirklich steuerbar wäre.
Stefan Lange: Das sprechen wir im Positionspapier konkret an: Weder die Wissenschaftspolitik noch die Wissenschaftsorganisationen haben eine klare Vorstellung davon, wie ein Gesamtsystem aus Wissenschaft und unterstützenden Informationsinfrastrukturen eigentlich aussehen soll. Ein solches Zielbild wäre wichtig – selbst wenn es nur vage umrissen wäre –, um das, was wir oft als "Wimmelbild" bezeichnen, also die Vielzahl an Maßnahmen, Förderprogrammen und Initiativen, in eine kohärente Richtung zu entwickeln. Nur so entsteht mehr als die Summe der Einzelteile – ein Zusammenspiel, das echten Mehrwert schafft, vor allem für die Nutzerinnen und Nutzer von Forschungsdaten und anderen Infrastrukturleistungen.
Gehring: Ein Zielbild ist kein Masterplan. Es entsteht im Aushandlungsprozess – und bleibt wandelbar. Das verstehen wir unter Reflexivität: keine Fünfjahrespläne für das System wissenschaftlicher Informationsinfrastrukturen, sondern ein Aufeinanderzubewegen, die Bereitschaft zum Miteinander-Verändern.
Lange: Genau – ein Zielbild kann sich verändern. Wir verstehen das als eine Daueraufgabe: ein strukturierender Prozess, idealerweise angestoßen durch die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern, der kontinuierlich weiterläuft.
Die GWK als Moderator eines wissenschaftlichen Selbstfindungsprozesses?
Lange: Schon in der Bund-Länder-Vereinbarung zur NFDI war die Idee angelegt, den gesamten Prozess wissenschaftlich zu begleiten – etwa über Begleitforschung, die analysiert, wo Synergien entstehen, wie sich das auf die Nutzergemeinschaft auswirkt, ob die angestrebten Wirkungen eintreten. Aber das ist so nicht umgesetzt worden.
Was wir jetzt vorschlagen, geht über klassische Begleitforschung hinaus: Es braucht einen Prozess, der auch die Wissenschaftspolitik aktiv einbindet. Aufbauend auf einer empirischen Kartierung sollten die Stellschrauben des Systems kontinuierlich justiert werden – damit das Zusammenwachsen der verschiedenen Infrastrukturlinien nicht aus dem Blick gerät, sondern gezielt gestaltet werden kann.
"Wir haben einen Überinvest in Anfänge. Überall werden
neue Straßen gebaut – aber jeweils nur drei Meter lang."
Sie haben viel über Zielbilder und Reflexivität gesprochen – aber einen Begriff haben Sie noch nicht wieder aufgegriffen: Ownership. So schillernd und vieldeutig er ist: Offenbar hängt viel von ihm ab.
Gehring: Das, was wir eingangs mit Ownership ins Spiel brachten, meint genau das: Verantwortung übernehmen. Im Zusammenhang mit der NFDI wird gern von "Verortung" gesprochen: Man "verortet" eine Infrastruktur bei einer Institution. Aber die entscheidende Frage ist doch: Wird an diesem Ort dann auch Verantwortung übernommen? Fühlt man sich wirklich verpflichtet, das, was einem zugewiesen wurde, auch zu tragen?
Womit wir bei dem Widerspruch zwischen Ownership und Projektitis wären.
Gehring: Es geht uns nicht darum, rund um Informationsinfrastrukturen die Projektförderung vollkommen abzuschaffen. Pilotprojekte haben ihre Berechtigung und ihren Platz. Die Idee der Verstetigung in unserem Papier ist demgegenüber eine Metapher für mehr Verbindlichkeit und Systematik. Es geht um ein Ineinandergreifen von Forschung und Infrastruktur, agil und zugleich nachhaltig – von der kurzzeitigen Datennutzung bis zur Langzeitarchivierung. Wir machen Vorschläge, wie das gehen kann.
Lange: Es gibt längst bewährte Verfahren, um zu entscheiden, welche Projekte auf Dauer gestellt werden und welche nicht – etwa im Forschungsbautenprogramm oder bei der Förderung großer strategischer Tatbestände bei Bund-Länder-geförderten Forschungseinrichtungen. Da prüft man nach Kriterien wie struktureller Relevanz, internationaler Bedeutung oder überregionaler Wirkung. Solche Verfahren könnten – bei entsprechend angepassten Kriterien –auf den Bereich der Informationsinfrastrukturen übertragen werden – nur ist das bislang nicht geschehen.
Wenn man Infrastrukturen wie ein Straßennetz denkt, braucht es beides: Strecken, die dauerhaft gepflegt werden – und die Entscheidung, andere stillzulegen. Beim Stilllegen tun sich Politik und Wissenschaft bislang schwer, lieber knüpft man Projektförderung an Projektförderung.
Gehring: Ich würde bei Ihrer Straßenmetapher den Fokus leicht verschieben. Das Problem sind gar nicht die schmerzhaften Stilllegungen, die keiner wagt. Sondern: Es werden derzeit überall neue Straßen gebaut – aber jeweils nur drei Meter lang. Wir haben einen Überinvest in Anfänge. Und dann wird abgewartet, ob quasi der "Markt" schon zeigen wird, welche Strecke sich lohnt. Doch so vorzugehen, funktioniert bei Infrastrukturen nicht. Was hier fehlt, ist der Mut – und die Mechanismen –, aus diesen vielen Fragmenten ein tragfähiges, dauerhaftes Netz zu machen.
Zu viele Straßenanfänge statt fertige Straßen?
Gehring: Exakt. Ich habe keine Sorge, dass wir jemandem sagen müssten: Deine schöne Straße brauchen wir nicht mehr. Viel eher müssten wir den Straßenanfangsbauern sagen: Wenn ihr eure Strecke nicht zu Ende bauen wollt, dann stellt besser gar keinen Antrag.
Lange: Ich glaube, die Wissenschaftspolitik wird diesen Weg gehen müssen. Denn die Nachfrage nach Forschungsdaten kommt längst nicht mehr nur aus der Wissenschaft selbst – auch die Wirtschaft hat deren Potenzial erkannt. Daten werden zur Schlüsselressource für Innovation.
"Wenn das System zu schwach ist,
übernehmen am Ende Digitalkonzerne."
Gehring: Noch plastischer ausgedrückt: Es geht um die Zukunft unseres Wohlstandes. Es geht um Wertschöpfung durch die Wissenschaft. Datengetriebene Wissenschaft und ihre Infrastrukturen erzeugen Wissen – das ist ihr Wert. Und den gilt es zu sichern: Wenn das System zu schwach ist, übernehmen am Ende Digitalkonzerne – schleichend, weil es keine souveräne, tragfähige Infrastruktur im Wissenschaftssystem gibt. Zum Glück ist das Problembewusstsein in der Politik gewachsen. Aber es geht nicht nur um Souveränität, sondern auch um Effizienz. Wenn die Selbststeuerung der Wissenschaft in diesem Bereich zu zögerlich bleibt, wird falsch investiert, Kosten laufen aus dem Ruder – und irgendwann wird dann diffus gespart, statt gezielt gesteuert.
Der Einstieg in ein strategisch stimmigeres System von Informationsinfrastrukturen hat laut Ihren Empfehlungen auch deutliche Konsequenzen für die Personalstrukturen in den Einrichtungen. Welche?
Gehring: Der RfII hat schon vor einigen Jahren ein Papier zu den Personalbedarfen im Wissenschaftssystem veröffentlicht – gerade auch mit Blick auf digitale Infrastrukturen. Und wie nun ebenso der Wissenschaftsrat in seinem NFDI-Papier gleich zu Beginn betont: Eine nationale Forschungsdateninfrastruktur, so wie wir sie denken, lässt sich nicht als befristete Aktivität organisieren. Sie ist eine mittel- und langfristige Aufgabe. Das war eigentlich immer klar, doch das deutsche Fördersystem tut sich schwer damit.
Warum?
Gehring: Wir befinden uns in einer schizophrenen Situation. Die Beteiligten, die das Datenhandeln in der NFDI endlich nachhaltig mit Leben füllen, sitzen auf befristeten Stellen in Projekten, die sich wie typische DFG-Förderung anfühlen – temporär, mit eingebautem Ablaufdatum. Das ist nicht die Schuld der DFG, im Gegenteil: Dass sie die Konsortienauswahl übernommen hat, war ein Glücksfall. Doch wer sich persönlich und langfristig engagieren soll, braucht Perspektiven. Es geht um Kompetenzentwicklung, neue Berufsbilder, professionelle Funktionen innerhalb der NFDI. Diese Aufgaben sind neu, sehr wissenschaftsnah, und sie gehören ins Herz der Forschung – nicht an den Rand.
Der drohende Verlust wichtiger Daten und Plattformen in den USA hat viele aufgeschreckt. Ist Deutschland – trotz aller Zersplitterung, trotz fehlender Koordinierung – wissenschaftlich-infrastrukturell eigentlich gut aufgestellt für die geopolitisch unruhige Welt, in der wir uns gerade bewegen? Haben wir genug Souveränität, um im Datenbereich unabhängig und krisenfest zu agieren?
Gehring: Ich antworte auf Ihre Frage mit "Ja" und möchte das auch als Ermutigung ans System verstanden wissen. Natürlich sieht man immer erst einmal, was alles fehlt, welche Ressourcen noch gut wären. Die Politik befeuert parallel mit dem Narrativ, andere seien uns weit voraus, auch eine gewisse Angst.
Lange: Um die Wissenschaftspolitik an dieser Stelle auch einmal zu loben – das tun wir ja nicht ständig: In den vergangenen 20 Jahren hat sie die sogenannte Friedens- und Globalisierungsdividende stark in die Wissenschaft investiert. Im europäischen Vergleich war das beachtlich. Das wird nicht ewig so weitergehen, das ist klar. Aber dieses politische Investment hat uns in Deutschland in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht.
Gehring: Hier ist die große Vielfalt unseres Wissenschaftssystems, auch im Föderalen, eindeutig seine Stärke und Ausdruck von Resilienz. Sie schafft Binnenwettbewerb, Kooperation und Stabilität.
"Forschungsdaten sind nicht nur Ressource – sie sind Teil wissenschaftlicher und digitaler Souveränität."
Lange: Und von dieser Resilienz brauchen wir noch mehr. Wenn in der internationalen Kooperation plötzlich ein Glied der wissenschaftlichen Wertschöpfungskette ausfällt – etwa weil Daten nicht mehr erhoben oder gesichert werden können –, sorgt das für Aufregung in der Wissenschaftspolitik. Angesichts solcher externen Schocks sprechen wir in unserem Papier von der Notwendigkeit "kluger Redundanz", die keine mangelnde Effizienz bedeutet, sondern genau das Gegenteil. Denn Forschungsdaten sind nicht nur Ressource, sie sind Teil wissenschaftlicher und digitaler Souveränität. Und entsprechend müssen wir sie behandeln.
Was folgt daraus?
Lange: Daraus folgt, dass wir jetzt, unter den neuen, schwierigeren Bedingungen, Zuständigkeiten klug festlegen und Prozesse strategisch verzahnen müssen – damit auch mit weniger Geld weiterhin exzellente wissenschaftliche Ergebnisse möglich sind. Und ich bin überzeugt: Wenn die Impulse, die jetzt aus den Beratungsgremien wie Wissenschaftsrat und RfII kommen, ernst genommen und aufgegriffen werden, dann ist Deutschland, gerade im europäischen Vergleich, sehr gut aufgestellt.
Gehring: Wenn wir über den Gesamthaushalt der Wissenschaft reden, mag das so sein, dass mit weniger Geld weiter Exzellenz möglich ist. Aber um die vorhandenen Potenziale wirklich zu heben, muss das Volumen für die NFDI steigen. Das ist die zweite, ebenso wichtige Botschaft von Wissenschaftsrat wie auch RfII – und kein Widerspruch zur ersten.
Lange: Dazu gehört auch Dinge beenden zu können, wenn sie nicht mehr tragen – im Interesse des Gesamtsystems.
Zwischen der Einsicht, dass man auch mal etwas einstellen sollte, und der konkreten Entscheidung, was genau eingestellt wird, liegen allerdings immer noch die erwartbaren Widerstände der Betroffenen.
Gehring: Digitalität ist längst keine Zukunftsspielwiese mehr. Sie ist da, sie prägt Forschungspraxis – und sie verlangt endlich ernst gemeinte organisatorische Strukturen. Herr Lange mag mir da widersprechen, aber: Wirklich Dysfunktionales bleibt selten bestehen, wenn es nicht weiter gefördert wird.
Lange: Da widerspreche ich Ihnen nicht. Das eigentliche Problem sind Fördertöpfe, die als Selbstläufer wirken – als gäbe es kein Morgen, und vor allem: kein Gestern, in dem das alles schon mal gefördert wurde.
Kommentare
#1 - Was ist RfII ?
Ist ja alles schön und gut zu dem Thema. Aber man tappt bei den vielen Abkürzungen schnell im Dunklen als Not-Insider. Was ist denn RfII ?



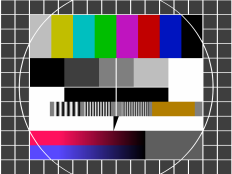




Neuen Kommentar hinzufügen