Frustrierend, ermüdend, wenig transparent
Bekommt man ein Kind während der Doktorarbeit, besteht gesetzlich die Möglichkeit, zwei Jahre länger von der Universität beschäftigt zu werden.Warum passiert das so selten?
WENN LEONIE RUDOLFS von ihrer Erfahrung mit der Personalabteilung der Freien Universität (FU) erzählt, kehrt die Wut zurück. Rudolfs, die eigentlich anders heißt, ist 36, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern im Grundschulalter, promoviert in Bildungswissenschaft.
Sie sei nach Auslaufen einer Projektstelle während ihrer Promotion davon ausgegangen, die Uni ermögliche ihr die Weiterqualifizierung, erzählt sie. "Doch obwohl meine Professorin mich als ihre Mitarbeiterin einstellen wollte, hat man mir einen Arbeitsvertrag verweigert." Die FU habe den Fall "über Monate verschleppt".
Mindestens zwei weiteren jungen Wissenschaftlerinnen mit Kindern an der FU ist es genauso gegangen: Sie befanden sich mitten in ihrer Promotion, ihre Professor:innen wollten sie unbedingt haben, das Geld für die Stelle am Lehrstuhl war da – doch die Personalabteilung sagte: Rechtlich ausgeschlossen. Das Problem ist, das stimmte womöglich gar nicht.
Wie kann das sein? Die Antwort beginnt mit dem langen Wort Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG). Es regelt zurzeit, dass nach sechs Jahren befristeter Beschäftigung bis zur Promotion an deutschen Unis Schluss ist. Mit Doktortitel gibt es nochmal sechs Jahre, spätestens dann muss eine Dauerstelle her. Per Zeitvertrag ist die Weiterarbeit sonst allenfalls noch auf einer drittmittelfinanzierten Stelle möglich.
Es gibt aber Ausnahmen, etwa zählt die sogenannte "familienpolitische Komponente": Für jedes minderjährige Kind können laut einem Paragrafen des WissZeitVG akademische Arbeitgeber zwei Jahre an die maximale Befristungszeit dranhängen. Die Betonung auf Können – eine Verpflichtung per Gesetz dazu gibt es bislang nicht.
Rudolfs hatte sich auf ihre mit der Professorin abgesprochene – erstmals haushaltsfinanzierte – Doktorandenstelle gefreut. Im Januar 2023 sollte es losgehen, ein nahtloser Übergang von ihrer bisher drittmittelfinanzierten Stelle. Ihre Chefin reichte den Antrag bei der Personalabteilung im August 2022 ein, doch dann passierte über Monate nichts. Kein Wort von der Personalabteilung, trotz mehrerer Nachfragen. Rudolfs meldete sich vorsorglich arbeitssuchend.
Verzögert über Monate
Selbst als ihre Professorin die FU-Verwaltung per Fristsetzung zum Handeln aufforderte, gab es keine Antwort. Dafür sickerte irgendwann informell durch, dass das nichts werden würde mit der Stelle. Im Januar 2023, Rudolfs hätte längst angestellt sein sollen, kam von der Personalabteilung ein Zweizeiler, die Einstellung auf einer Haushaltsstelle sei nicht möglich. Ohne jede Begründung.
Eine Nachfrage bei der Pressestelle der FU zeigt, dass dort die horrende Bearbeitungszeit und Nicht-Kommunikation, die Rudolfs so frustriert hat, nicht bestritten wird. "Bedauerlicherweise" gebe es derzeit "allgemein Verzögerungen bei der Bearbeitung von Einstellungsvorgängen und Personalanträgen". Schuld seien "demografische Veränderungsprozesse und Folgen des Fachkräftemangels". Man steuere aber bereits dagegen an.
Und wie ist das nun mit der familienpolitischen Komponente? Die lasse sich bei Neueinstellungen bedauerlicherweise rechtlich nicht umsetzen, betont die Pressestelle. Beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hierzu nachgehakt, teilt eine Sprecherin mit, man könne sich zu Einzelfällen nicht äußern.
Grundsätzlich aber gelte: Falls an eine Drittmittelbefristung eine Qualifizierungsbefristung anschließt, "greifen die Verlängerungen der Höchstbefristungsgrenze aufgrund der familien- und behindertenpolitischen Komponenten." Ein neuer Vertrag wäre also kein Hinderungsgrund – zumal der alte wie der neue Arbeitgeber in Rudolfs’ Fall FU heißen sollte.
Dort gibt man sich verwundert. "Wir sind bislang von einer anderen Rechtsauffassung ausgegangen." Und auf welcher Grundlage genau? "Wir wissen, dass auch andere Universitäten unsere Rechtsauffassung zu haushaltsfinanzierten Anschlussverträgen nach Drittmittelbeschäftigung teilen und das so handhaben", lautet die Antwort nur. Die Sprecherin ergänzt aber, man werde die Rechtslage jetzt noch einmal prüfen.
Alles nur ein mögliches Missverständnis? Wer mit Anna-Thekla Jäger spricht, kann daran seine Zweifel bekommen. Jäger ist 35, Mutter von zwei Kitakindern und promoviert ebenfalls an der FU. Wie Rudolfs wollte sie in Absprache mit ihrem Professor von einer Drittmittelstelle auf eine Haushaltsstelle wechseln und parallel die Verlängerung in Anspruch nehmen – was die Personalstelle abgelehnte.
Ein Gespräch mit der Verwaltung sei dann, wie Jäger sagt, "frustrierend, ermüdend und wenig transparent verlaufen", woraufhin sie "die große Trommel gewirbelt" habe. Jäger sprach mit der Frauenbeauftragten, mit dem FU-Familienbüro, sie bekam eine Broschüre der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in die Hand gedrückt, in der explizit stand: Folgt auf einen Drittmittelvertrag eine Haushaltsstelle zur Qualifizierung, "kann die familienpolitische und behindertenpolitische Komponente zur Anwendung kommen". Doch jedes Argumentieren mit der Rechtslage laut Broschüre hätte sie gegenüber der FU-Personalstelle als vergeblich empfunden, sagt Jäger, woraufhin sie es gar nicht mehr versuchte. Während Leonie Rudolfs berichtet, sie habe die Broschüre sogar an die Personalabteilung geschickt.
Die Gewerkschaft vermutet denn auch bei vielen Hochschulen in Deutschland Methode hinter der zurückhaltenden Anwendung der freiwilligen Verlängerungsoptionen, zu denen auch der Nachteilsausgleich bei Behinderungen zählt. "Viele Arbeitgeber lehnen beide Komponenten grundsätzlich ab", sagt der GEW-Vizevorsitzende Andreas Keller.
In der Regel keine Verlängerung
Tatsächlich belegte eine vom BMBF in Auftrag gegebene unabhängige Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vergangenes Jahr: 42 Prozent der befragten Personalabteilungen bundesweit antworteten, "dass es diese Fälle bei ihnen nicht gebe". Und die Autoren kommentierten: "Der hohe Wert überrascht." In einer repräsentativen Stichprobe kam die Studie auf lediglich 1,1 Prozent aller befristeten Wissenschaftlerarbeitsverträge bundesweit, die aufgrund der Kinderbetreuungs-Verlängerungsoption liefen.
Und wie viele davon gibt es an der FU? Aktuell zwölf, sagt die Sprecherin – von rund 1000 Arbeitsverträgen.
Die GEW fordert für die bevorstehende WissZeitVG-Novelle unter anderem, aus der Kann- eine Muss-Bestimmung zu machen, also, sagt Andreas Keller, "einen Anspruch auf Vertragsverlängerung bei Kinderbetreuung, Behinderung/chronischer Erkrankung, Pflege Angehöriger und Nachteilen aus der Coronapandemie".
Anna-Thekla Jäger und Leonie Rudolfs hatten Glück. "Ich habe zeitnah eine andere Drittmittelstelle gefunden, da kann ich jetzt bis Herbst 2025 weitermachen, allerdings auf einem Forschungsprojekt, das nicht meins ist", sagt Jäger. Auch Rudolfs berichtet, ihre Professorin habe gewirbelt – und erreicht, dass sie noch einmal für anderthalb Jahre auf Drittmittelstellen arbeiten kann. Was dann kommt, wisse sie noch nicht. Was sie wisse, sagt Rudolfs: So eine Geringschätzung will sie nicht noch einmal erleben.
Dieser Beitrag erschien in leicht gekürzter Fassung auch im Tagesspiegel.
In eigener Sache: Bitte unterstützen Sie diesen Blog
Die Zahl der Blog-Besucher steigt weiter, doch seine Finanzierung bleibt prekär. Was folgt daraus?
Kommentare
#1 - Solche und ähnliche Fälle gibt es an vielen…
#2 - Ganz unabhängig davon, dass das hier beschriebene Vorgehen…
"ihre mit der Professorin abgesprochene – erstmals haushaltsfinanzierte – Doktorandenstelle". Es muss endlich aufhören, dass Promovierendenstellen "abgesprochen" werden. Stellen gehören ausgeschrieben und in einem qualitätsgesicherten Prozess besetzt. Diese Mauschelei und der Ausschreibungsverzeicht bei wissenschaftlichen Stellen unterhalb der Professur befeuern massiv eine transparente Stellenpolitik in der Wissenschaft und leistet dem Machtmissbrauch immensen Vorschub.
#3 - @Edith Riedel:Sie scheinen den Fall Rudolfs gar nicht…
Sie scheinen den Fall Rudolfs gar nicht verstanden zu haben. Hier geht es doch nicht um Machtmissbrauch seitens der betreuenden Professorin. Frau Rudolfs war bereits mitten im promotionsprozess und wollte ihre Promotion zu ende bringen auf einer Haushaltsstelle, die zur Verfügung stand. Es ist ärgerlich, wenn sachfremd immer gleich von Machtmissbrauch gefasel wird - verzeihung - sobald vom handeln von professsoren die rede ist.
#4 - Liebe*r "Wie bitte?", ich habe den Fall von Frau Rudolfs…
Auch wenn Frau Rudolfs sich bereits im Promotionsprozess befand, und die Haushaltsstelle zur Verfügung stand, sollte meines Erachtens eine Ausschreibung stattfinden. Wenn Frau Rudolfs für die Stelle geeignet ist, wird sie in einem Bewerbungsverfahren dann auch erfolgreich sein. Wenn sie nicht für die Stelle geeignet ist, dann sollte sie sie auch nicht bekommen.
Ein Großteil der wissenschaftlichen Stellen unterhalb der Nachwuchsgruppe oder Professur wird derzeit ohne Ausschreibung vergeben. Das behindert eine transparente Stellenpolitik im Wissenschaftsbetrieb und unterstützt, und dabei bleibe ich, die machtmissbräuchlichen Strukturen, die an Hochschulen leider sehr verbreitet sind.
Ob in dem geschilderten Fall machtmissbräuchlich gehandelt wurde, kann ich nicht einschätzen, dazu fehlen mir die Details. Ich habe mich lediglich an der en passant wie selbstverständlich getätigten Aussage gestört, dass die Stelle ja abgesprochen gewesen sein. Jede abgesprochene Stelle bedeutet, dass viele andere junge Wissenschaftler*innen noch nicht einmal die Gelegenheit erhalten, sich vorzustellen und ihre Eignung zu beweisen.






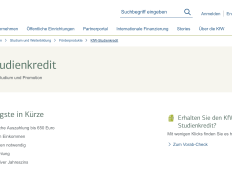

Neuen Kommentar hinzufügen