Wir müssen vom Reagieren wieder zum Gestalten kommen
Der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) und Rektor der Universität zu Köln, Joybrato Mukherjee, über den Wohnungsmangel für internationale Studierende, den Kampf der Hochschulen gegen Antisemitismus und die Rolle des DAAD in einer Welt von Kriegen und Krisen.

Joybrato Mukherjee, 50, ist seit dem 1. Januar 2020 Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD). Seit 2023 ist er zudem Rektor der Universität zu Köln, davor war er von 2009 bis 2023 Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen. Foto: Kay Herschelmann.
Herr Mukherjee, Deutschland ist zur weltweiten Nummer 3 der beliebtesten Ziele internationaler Studierender aufgestiegen. Begegne ich einem glückli- chen DAAD-Präsidenten?
380.000 internationale Studierende,Australien überholt,den Ruf als leistungsstarkes Wissenschaftssystem gestärkt – natürlich ist das eine schöne Momentaufnahme und Ausdruck dessen, was unsere Hochschulen in den vergangenen zehn, zwanzig Jahren geleistet haben. Aber es ist eben eine Momentaufnahme, und auf der dürfen wir uns nicht ausruhen.
Sehen Sie die Gefahr?
Ich sehe in Umfragen unter internationalen Studierenden und Studieninteressierten, an welchen Stellen wir besser werden müssen. Es gibt heute viel mehr englischspra- chige Studiengänge als früher, aber die Internationalisierung des Lehr- und Lernan- gebots bleibt eine Dauerherausforderung, bei der es um mehr geht als nur die Sprache. Wir müssen uns – Stichwort Willkommenskultur – fragen, ob wir abseits der Hochschulen als Gesellschaft in allen Regionen darauf vorbereitet sind, Studierende aus dem Ausland so zu empfangen, wie sie es erwarten dürfen.
Und, sind wir es?
Ich stelle zum Beispiel fest, dass Ausländerbehörden in einigen Kommunen nicht das Personal zur Verfügung haben, das sie bräuchten. Es ergibt sich ein Spannungsver- hältnis, wenn wir einerseits ein international attraktiver Studienstandort sein wollen, andererseits aber nicht flächendeckend die nötigen Ressourcen dafür zur Verfügung stellen.
Ist Willkommenskultur nur eine Frage der Ressourcen oder auch der Mentalität?
Die Mentalität spielt sicher auch eine Rolle. Ich würde mich aber davor hüten, in der Hinsicht pauschale Aussagen zu treffen. Dafür sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Städten und Regionen und je nach Verortung der Menschen im politischen Spektrum zu groß. Was man konstatieren muss: Obwohl wir uns in Zeiten des Fachkräftemangels befinden, gibt es in bestimmten Regionen bei manchen Betrieben nicht die Bereitschaft, Menschen ausländischer Herkunft einzustellen – selbst nachdem sie einen deutschen Studienabschluss erworben haben. Hier können wir als DAAD allein wenig ausrichten, es handelt sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
"Wir brauchen eine Sprachenpolitik, die dem Fachkräftemangel und dem verschärften internationalen Wettbewerb um Studierende angemessen ist. Ich benutze hier bewusst die Mehrzahl 'Sprachen'".
Womöglich liegt ein Problem doch auch in den Hochschulen selbst. Wenn mehr englischsprachige Studiengänge dazu führen, dass mehr internationale Studierende angezogen werden, die dann am Ende ihres Studiums nicht fließend Deutsch sprechen, werden viele von ihnen in der mittelständisch geprägten Wirtschaft keine Chance auf einen Job erhalten.
Darum müssen wir beides hinbekommen. Wir brauchen eine Sprachenpolitik, die dem Fachkräftemangel und dem verschärften internationalen Wettbewerb um Studierende angemessen ist. Ich benutze hier bewusst die Mehrzahl "Sprachen": Ja, wir brauchen mehr international ausgerichtete Studienangebote, in englischer Sprache, möglicherweise auch in anderen modernen Fremdsprachen. Internationalisierung ist nicht zwangsläufig gleich Anglisierung. Auf jeden Fall sind wir durch solche Studiengänge attraktiv für junge Talente, die noch nicht über die nötigen Deutschkompetenzen verfügen. Zum anderen müssen wir als deutschsprachiges Land sicherstellen, dass wir im Laufe des Studiums Stück für Stück die nötigen Deutschkenntnisse vermitteln, die in der Regel für den Arbeitsmarkt gebraucht werden – und ohne die man sich auf Dauer bei uns kaum heimisch fühlen wird. Wenn wir beides schaffen, wird eine vernünftige Sprachenpolitik daraus.
Also viel Englisch, Spanisch, Französisch in den unteren Semestern und ein verpflichtender Deutschanteil, der in höheren Semestern immer weiter ansteigt?
Das ist ein mögliches Modell. Ein anderes besteht darin, Studierende für englischsprachige Masterstudiengänge zu gewinnen und parallel zum Studium die Deutschkenntnisse, die viele schon aus ihren Heimatländern mitbringen, durch intensive Deutschkurse zu perfektionieren. Wichtig ist, dass man die Englischsprachigkeit oder jede andere Fremdsprache nicht gegen den Erwerb der deutschen Sprache ausspielt.
Fast noch drängender als die Fragen von Bürokratie,Willkommenskultur und Sprache scheinen derzeit die Sorgen vieler internationaler Studierender auf dem Wohnungsmarkt zu sein. Entsteht da ein ernstlicher Wettbewerbsnachteil für Deutschlands Hochschulen?
In den großen Metropolen wie Berlin, Hamburg, München und Köln ist der studentische Wohnungsmarkt extrem angespannt, natürlich trifft das insbesondere auch die internationalen Studierenden. Ich kann aber nicht erkennen, dass die Lage in anderen Ländern durchweg rosiger ist. Die Niederlande etwa fahren ihr internationales Studierendenmarketing genau deshalb massiv zurück, nämlich nicht aus irgendwelchen rechtspopulistischen Motiven, sondern weil der Mietmarkt so umkämpft ist – was auch mit der stark gestiegenen Zahl internationaler Studierender und Forscher*innen zusammenhängt.
Was fordern Sie von Bund und Ländern?
Wir sehen, dass im gesamten deutschen Immobilienmarkt zu wenig neu gebaut wird. Daraus kann man folgern, dass die schon stark gestiegenen Mietpreise weiter durch die Decke schießen werden, zunehmend auch in den kleineren und mittelgroßen Städten. Wir brauchen also viel mehr bezahlbaren Wohnraum, insbesondere auch viel mehr bezahlbaren studentischen Wohnraum. Die diesbezüglichen Investitionen sind dringend nötig. Ich sehe dazu auch die politische Bereitschaft, das Thema ist nicht umsonst prominent im Koalitionsvertrag vertreten.
Sehen Sie auch das politische Handeln?
Dass gehandelt wird, ist meine Erwartung und meine Hoffnung. In haushalterisch schwierigen Zeiten verlangt dies aber von den politischen Entscheidungsträgern, die entsprechenden Prioritäten zu setzen, und zwar auf allen Ebenen, von den Kommunen über die Länder bis hinauf zum Bund. In vielen anderen Staaten liegt die Bewirtschaftung studentischen Wohnraums in der Hand der Hochschulen, in Deutschland haben wir dafür zumeist die Studierendenwerke. Damit diese international ungewöhnliche Arbeitsteilung kein limitierender Faktor ist, müssen Bund und Länder die Studierendenwerke hinreichend unterstützen. Das Bund-Länder-Programm "Junges Wohnen" ist ein Anfang.
Die Abbrecherquoten von internationalen Studierenden liegen deutlich über denen ihrer einheimischen Kommilitonen. Das ist seit vielen Jahren bekannt, doch tun die Hochschulen genug, um das zu ändern?
In der Regel haben internationale Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, einen Nachteil, den man nicht wegdiskutieren kann. Wir sehen aber, dass es Unterschiede etwa zwischen Bachelor- und Masterstudierenden gibt. Im Masterbereich liegt der Studienerfolg viel höher, was mit der anderen Klientel, aber auch mit dem kompensatorischen Effekt zusammenzuhängen scheint, den die im Master sehr viel häufigeren englischsprachigen Studiengänge erzeugen. In jedem Fall müssen wir über die Rahmenbedingungen nachdenken, die mehr sind als die Sprache und die auch die kulturellen Besonderheiten eines Wissenschaftssystems umfassen. So wird im deutschen System mit seinen zum Teil sehr großen Hochschulen das selbstständige Arbeiten viel stärker abverlangt, verbunden mit deutlich schlechteren Betreuungsrelationen, als die meisten Studierenden es etwa in den USA oder in Australien antreffen würden. Deshalb legen wir als DAAD bei unserer großen Fachkräfteoffensive so viel Wert auf die Betreuung als ein wichtiges Element.
"In den meisten Teilen Deutschlands fehlt der politische Konsens, das Thema Bezahlstudium erneut anzugehen."
Eine bessere Betreuung ist aufwendig und teuer. Die TU München macht es den von Ihnen genannten Staaten nach und erhebt Studiengebühren für Studierende aus Drittländern – in einer international eher unterdurchschnittlichen, für Deutschland aber bislang ungekannten Höhe. Was sagen Sie als Rektor der Universität zu Köln dazu: nachahmenswert?
Anders als in Bayern hätten wir in NRW die rechtlichen Möglichkeiten dazu gar nicht. Und das einzige Bundesland, in dem die Hochschulen sogar Studienbeiträge für Studierende aus Drittstaaten erheben mussten, Baden-Württemberg, will diese wieder abschaffen. Was zeigt: In den meisten Teilen Deutschlands fehlt der politische Konsens, das Thema Bezahlstudium erneut anzugehen. Abgesehen davon bin ich gespannt auf die weitere Entwicklung an der TUM. Allerdings – und das meine ich als Kompliment – kann man die TUM nicht zum Maßstab machen, weil sie eine über viele Jahre aufgebaute internationale Marke besitzt wie keine andere deutsche Hochschule. Insofern kann sich die TUM am ehesten leisten, solche Studienbeiträge zu erheben. Als DAAD-Präsident wiederum möchte ich anmerken, dass es zum international wahrgenommenen Markenkern des deutschen Hochschulsystems gehört, hohe Qualität in der Breite anzubieten, und das eben individuell gebührenfrei.
Was macht es eigentlich mit diesem Markenkern, wenn Deutschland seit dem 7. Oktober immer wieder mit antisemitischen Vorfällen von sich reden macht und in Potsdam ein Geheimtreffen stattfand, auf dem über die "Remigration von Millionen Menschen" weg aus Deutschland schwadroniert wurde?
Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit sind ja leider keine neuen Themen, sie begleiten auch die Hochschulen, die Teil der Gesellschaft sind, seit Jahren. Ich würde hier aber abschichten wollen: Wir dürfen eine rationale, argumentationsbasierte Diskussion über Migration nicht tabuisieren. Für mich ist die Grenze da überschritten, wo Menschen definieren, wer "richtiger" Deutscher sein darf und wer, um einen Kampfbegriff von rechts außen zu nehmen, nur "Passdeutscher" sei. Das erinnert an die dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte, in denen plötzlich Teile des deutschen Volkes für nicht deutsch erklärt wurden. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, welchen Einfluss die aktuellen Ereignisse und Entwicklungen auf das Image Deutschlands bei internationalen Studierenden haben: Das werden wir erst mit Zeitverzug sehen. In Gesprächen mit unseren weltweiten Partnern hören wir jedenfalls von Sorgen angesichts des um sich greifenden Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus. Wir hören aber auch, dass die großen Demonstrationen gegen diese Umtriebe, wie wir sie überall in Deutschland erlebt haben, genauso wahrgenommen werden. Das stimmt mich hoffnungsvoll.
Der DAAD stellt jetzt Fördermittel gegen Antisemitismus und Rassismus zur Verfügung – allerdings nur eine Million Euro. Ist das mehr als Symbolik?
Das ist ein klares Zeichen, das wir mit Unterstützung des Auswärtigen Amts setzen – dem ich hierfür herzlich danke. Natürlich hoffen wir, dass die Hochschulen zu diesem Zweck noch von anderer Seite Geld erhalten. In Köln nehmen wir eigene Mittel in die Hand, um öffentliche Veranstaltungen zu organisieren, neulich zum Beispiel in Anwesenheit des israelischen Botschafters Ron Prosor. Der Sicherheitsaufwand war, leider, immens, aber es war uns wichtig, deutlich zu machen: Es ist in diesem Land eine Selbstverständlichkeit, dass der Botschafter des Staates Israel eine deutsche Universität besucht, um mit Studierenden zu diskutieren.
In Berlin war es neulich keine Selbstverständlichkeit mehr, dass eine Richterin des Obersten Gerichtshofs Israels nicht niedergeschrien wurde an einer deutschen Universität.
Ich bin froh, dass wir in Köln eine anregende, auch kritische Diskussion führen konnten, in einem vollen Hörsaal mit über 300 Studierenden. Es wurde beispielsweise explizit danach gefragt, ob die Selbstverteidigungsmaßnahmen Israels im Gaza-Streifen angemessen sind; es wurden die zivilen Opfer der Militäroperation thematisiert, und Botschafter Prosor hat sich allen Fragen gestellt. Ein solcher Diskurs ist unmöglich, wenn man sich gegenseitig niederschreit. Alle Mitglieder unserer Hochschulen tragen die Verantwortung, ihn möglich zu machen. Was meine Kolleg*innen in den Hochschulleitungen anbetrifft, so habe ich keinen Zweifel daran, dass sie alle ihnen möglichen Maßnahmen ergreifen, sobald es nötig wird.
Im Januar hat Ihre zweite Amtszeit als DAAD- Präsident begonnen, Herr Mukherjee. Was wird Ihr Leitmotiv sein, um in dieser so schwierigen Phase internationaler Konflikte Wissenschaftskooperationen zu gestalten?
Sie haben die entscheidende Vokabel gerade selbst benutzt: Gestalten.Angesichts einer Verkrisung der geopolitischen Rahmenbedingungen müssen wir vom Reagieren wieder zum Gestalten kommen. Für uns als DAAD kann ich in Anspruch nehmen, dass wir in den vergangenen Jahren mit einer Vielzahl von Strategiepapieren, mit Vorschlägen für neue Programme und Initiativen und mit der praktischen Weiterentwicklung unserer Austauschformate unseren Beitrag zu dieser Gestaltung geleistet haben. Das, was wir gerade erleben, ist kein Übergangsstadium, es wird nicht von Zauberhand eine neue Stabilität entstehen; Spannungen, Krisen und Interessenkonflikte werden allgegenwärtig bleiben und eher noch zunehmen.
Ist für wissenschaftliche Kooperationen aber nicht das Vertrauen ins Gegenüber konstitutiv? Wie kann man wissenschaftlich zusammenarbeiten,wenn man seinem Partner misstraut?
Die Antwort kann nicht binär sein – Vertrauen oder Misstrauen. Wie überall in der Politik und in den Beziehungen zwischen Staaten haben wir es mit Gradienten zu tun. Der Begriff "Wertegemeinschaft" wird weiter seine Berechtigung haben, weil es immer eine Gruppe von Staaten, Kulturen und Wissenschaftssystemen geben wird, zwischen denen eine vertrauensvolle und intensive Kooperation auf ähnlichem Wertefundament möglich ist. Es wird aber Systemrivalen geben, mit denen die Zusammenarbeit herausfordernd ist, die man trotzdem nicht ignorieren kann und mit denen man sich auf gemeinsame Spielregeln einigen muss. Beide Seiten müssen definieren, was für sie vertretbar und verantwortbar ist. Und zwischen beiden Extremen – um aus dem binären Denken herauszukommen – wird es viele Abstufungen geben, auch in den internationalen Wissenschaftsbeziehungen – mit Partnern, die sich weder der einen noch der anderen Gruppe zuordnen lassen, auch nicht zuordnen lassen wollen. So ein Beispiel ist etwa Vietnam: ein kommunistischer Staat, der aber seine eigenen Konfliktlinien zu seinem großen Nachbarn, der Volksrepublik China, hat. Es ist in unserem Interesse, die Beziehungen zu Vietnam aktiv zu gestalten.
"Ich plädiere dafür, dass wir in einer turbulenten Welt mit ihren sehr unterschiedlichen Interessenlagen unsere eigenen Überzeugungen zwar sehr klar kommunizieren, aber aufhören, die Gegenseite stets belehren zu wollen."
Vor ein paar Jahren sprachen Sie in Interviews noch von "schwierigen Partnerländern", jetzt sprechen Sie von Systemrivalen. Ist China von Ersterem zu Letzterem geworden?
China ist für Deutschland und die EU immer mehreres gleichzeitig: Partner, Wettbewerber, Systemrivale, je nach Kontext flackern die verschiedenen Attribute unterschiedlich stark auf. Den Begriff "schwierige Partner" haben wir im DAAD durch "herausfordernde Partner" ersetzt, denn es geht um den richtigen Umgang mit den Herausforderungen in den Beziehungen. Ich plädiere dafür, dass wir in einer turbulenten Welt mit ihren sehr unterschiedlichen Interessenlagen unsere eigenen Überzeugungen zwar sehr klar kommunizieren, aber aufhören, die Gegenseite stets belehren zu wollen. Jedes Land ist anders, selbst EU-Mitglieder können je nach ihrem innenpolitischen Zustand herausfordernde Partner sein, deshalb müssen wir mit jedem Land die richtige Umgangsweise finden.
Was ist die richtige Umgangsweise mit China?
Wir wollen auch künftig eng mit der chinesischen Wissenschaft zusammenarbeiten, das müssen wir auch. Aber natürlich gibt es Bereiche, in denen wir unsere eigenen Sicherheitsinteressen haben, in denen wir uns genau überlegen: Unter welchen Bedingungen können wir kooperieren, ohne ein zu hohes Risiko einzugehen? Im Zweifel muss das bedeuten, dass bestimmte Kooperationen unterbleiben. Umgekehrt pflegen wir seit vielen Jahren eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit in vielen Wissenschaftsfeldern, die wir problemlos fortführen können, so etwa in den Geisteswissenschaften.
Und in welchen Feldern sollten Kooperationen unterbleiben?
In unserem neuen China-Papier machen wir als DAAD deutlich: Es ist die Aufgabe jeder einzelnen Hochschule, diejenigen Bereiche in ihrem Portfolio zu benennen, die so starken Dual-use-Risiken ausgesetzt sind, die so stark unsere nationalen Sicherheitsinteressen berühren, dass man eine Zusammenarbeit lieber lässt. Das sind Diskursräume – Stichwort Zeitenwende –, die wir so vor zehn Jahren sicher nicht ausgeleuchtet hätten.
Haben Sie diese Entscheidung für Köln bereits getroffen?
Möglicherweise gibt es auch in Köln solche Bereiche, ja.Aber im Umgang mit herausfordernden Partnern sollte man nicht alle Fragen auf öffentlichen Marktplätzen besprechen. Das macht die andere Seite auch nicht.
So viel zum Thema Vertrauen zwischen wissenschaftlichen Kooperationspartnern.
So viel vor dem Hintergrund jüngster Ereignisse, wenn sogar die Bundeswehr abgehört wird. Wir haben in unserem China-Papier die drei Begriffe "interessengeleitet, risikoreflexiv und kompetenzbasiert" geprägt, und diese Begriffe sollten Leitmotiv sein für die Beziehungen zu China, aber auch zu anderen Staaten, die wir als herausfordernd ansehen. Wir müssen stärker als in der Vergangenheit unsere eigenen Interessen klar und deutlich artikulieren. Das ist vor dem Hintergrund unserer Geschichte nicht einfach, aber notwendig. Diese Artikulation wird übrigens von unseren chinesischen Partnern sogar begrüßt. Das Ziel in der Gestaltung von internationalen Wissenschaftskooperationen ist es ja nicht, dieselben Interessen wie die andere Seite zu haben, sondern die Interessen gegenseitig abzugleichen. Daraus ergibt sich die erwähnte Reflexion über die Risiken. Und alle Entscheidungen über Zusammenarbeit und Nicht-Zusammenarbeit, die daraus folgen, können wir sinnvoll nur mithilfe echter Kompetenz und mit fundiertem Wissen über das jeweilige Land treffen – und nicht auf der Basis irgendwelcher Anekdoten. Dies ist uns beim DAAD besonders wichtig.
Haben Sie den Eindruck, dass die öffentlichen Äußerungen der Bundesregierung zu China Ihren gerade formulierten Ansprüchen gerecht werden?
Ich habe das Privileg, an der Spitze einer Wissenschaftsorganisation zu stehen und insofern immer wieder die nötige Differenzierung anmahnen zu können. In der Politik herrschen mitunter andere Gesetzmäßigkeiten und Zwänge zur Zuspitzung. Wir sollten uns als Wissenschaft aber nicht in eine zu starke Zurückhaltung im Austausch mit China hineindrängen lassen. Es ist notwendig, die Beziehungen zu China differenziert und kritisch zu gestalten, aber die wissenschaftliche Kooperation an sich ist ohne Alternative. Die Volksrepublik hat das größte Wissenschaftssystem, das schon jetzt extrem leistungsfähig ist und beständig weiter an Bedeutung gewinnt. Wir dürfen auf keinen Fall in eine Spirale des Abschottens geraten. Das selbstbewusste Gestalten von Beziehungen – mit Risikobewusstsein, aber ohne Angst – ist das Gegenteil von Abschottung. Zugleich müssen und können wir als Wissenschaft Zuversicht vermitteln. Denn durch eine regelgeleitete internationale Zusammenarbeit werden die Dinge besser – das war immer so, das bleibt auch so.
"Wenn wir an der Universität Köln jetzt bei 45.000 Studierenden stehen, Tendenz weiter fallend, ist das eine positive und aus meiner Sicht alles andere als besorgniserregende Entwicklung."
Der Wissenschaftsratsvorsitzende Wolfgang Wick rechnet mit deutschlandweit stagnierenden bis zurückgehenden Studierendenzahlen. Gehört es künftig zu einer gelungenen Internationalisierungsstrategie, die freien Studienplätze mit noch mehr Studienanfängern aus dem Ausland aufzufüllen?
So habe ich das noch nicht betrachtet. Als Rektor einer der größten deutschen Universitäten, die vor wenigen Jahren noch bei weit über 50.000 Studierenden lag, kann ich nur sagen: Wenn wir jetzt bei 45.000 stehen, Tendenz weiter fallend, ist das eine positive und aus meiner Sicht alles andere als besorgniserregende Entwicklung. Wir kehren damit zu normalen, halbwegs vertretbaren Verhältnissen zurück – nach einer langen Phase des quantitativen Wachstums, die wir als Hochschulen gut verkraftet haben. Wir können jetzt aber den Hebel umlegen hin zu mehr Studienqualität und zu besseren Betreuungsrelationen. Da sind wir nämlich, ich sagte es anfangs, im internationalen Vergleich schlecht aufgestellt.
Vielleicht ergeht es Ihnen in Köln da einfach anders als in manch ländlicher Region, wo ganze Studiengänge und Fächer vor der Existenzfrage stehen?
Das mag sein, aber auch als DAAD-Präsident würde ich diese Aspekte wirklich trennen wollen. Wir gewinnen internationale Studierende und Promovierende aus einer gesellschaftlichen Verantwortung heraus, weil wir einen grassierenden Fachkräftemangel haben; weil wir mehr Talente aus dem Ausland brauchen für unseren Arbeitsmarkt; weil wir über diese Art des Austauschs internationale Wissenschaftskooperation betreiben. Wir rekrutieren sie nicht, um einfach unsere Studienplätze zu füllen.
Sie sprechen von gesellschaftlicher Verantwortung und meinen das Stopfen der Fachkräftelücke. Was ist eigentlich aus Deutschlands Verantwortung wirtschaftsschwächeren Ländern gegenüber geworden, denen wir ihre jungen Talente streitig machen?
Richtig ist, dass wir vor zehn Jahren beim DAAD wahrscheinlich kein Programm zur Fachkräftegewinnung aufgelegt hätten. Aber wir erkennen an, dass wir unseren Teil leisten müssen für die wirtschaftliche Prosperität unseres Landes, das erwarten auch unsere Geldgeber aus den verschiedenen Bundesministerien. Wobei das Auswärtige Amt oder das Bundesbildungsministerium bei der Frage naturgemäß unterschiedliche Perspektiven einnehmen als das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das mit guten Gründen auf die Gefahren eines Braindrains hinweist und die Bedeutung von fairer Migration in den Vordergrund rückt. Allerdings sollten wir auch diese Themen differenziert betrachten. In Gesprächen mit Botschafter*innen anderer Staaten höre ich immer wieder, dass sie unser Fachkräfte-Programm oftmals begrüßen. Zitat: "Machen Sie sich keine Sorgen, wir haben so viele junge Talente, wir sind froh, wenn Sie ihnen eine Perspektive bieten". Am Ende ist es wie immer eine Frage der richtigen Dosierung.
Dieses Interview erschien zuerst im DSW-Journal, Ausgabe 1/2024.
Kostenfreien Newsletter abonnieren
In eigener Sache
Dieser Blog hat sich zu einer einschlägigen Adresse der Berichterstattung über die bundesweite Bildungs- und Wissenschaftspolitik entwickelt. Bitte helfen Sie mit, damit er für alle offen bleibt.
Wie Sie Blog und Newsletter unterstützen können, erfahren Sie hier...



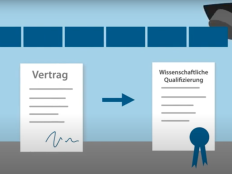



Neuen Kommentar hinzufügen