Brauchen wir mehr Medizinstudierende?
Um einen Ärztemangel zu verhindern, darf in Italien neuerdings jede und jeder ein Medizinstudium beginnen. Sind solch drastische Änderungen auch in Deutschland notwendig?

Bild: upklyak / freepik.
SEIT DIESEM JAHR darf in Italien jede und jeder mit Hochschulzugangsberechtigung ein Medizinstudium beginnen – ganz ohne Zulassungsbeschränkungen. Erst nach einem "semestre aperto", einem "offenen Semester", entscheidet ein nationaler Test, wer weitermachen darf. Wissenschaftsministerin Anna Maria Bernini sprach im April von einem "Durchbruch", als die neue Regelung bekannt wurde. Anders sah das der Ärzteverband Anaao-Assomed. Dessen Generalsekretär Pierino Di Silverio kritisierte damals laut Euractiv ein "populistisches, demagogisches Manöver, das am Ende nicht nur den Politikern, sondern auch tausenden Familien schaden wird".
Kritik hatte es in Italien allerdings zuvor auch an den hohen Eingangshürden für Studienanfänger gegeben – und das in Zeiten eines Ärztemangels. Eine Debatte, die an Deutschland erinnert, wo der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einst mit der Forderung nach 5.000 Studienplätze Furore machte, anders werde man die Versorgung der Babyboomer-Generation in naher Zukunft nicht mehr gewährleisten können. Lässt sich da womöglich doch etwas von Italien abgucken?
Hierzulande ist der Zugang zum Medizinstudium weiter streng reguliert. Die Zulassung erfolgt hauptsächlich über drei Quoten: 30 Prozent der Plätze gehen an die Abiturbesten, zehn Prozent laufen über die sogenannte "zusätzliche Eignungsquote", bei der die Schulnoten keine Rolle spielen – und die übrigen 60 Prozent werden von den Hochschulen über eigene Auswahlverfahren vergeben.
Abinote nicht allein entscheidend
Wichtig ist dabei: Seit einem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts von 2017 darf der Abischnitt nicht mehr allein ausschlaggebend sein. Die Richter forderten, dass neben der Note verpflichtend mindestens ein weiteres, nicht schulnotenbasiertes Kriterium in die Auswahl einfließt – etwa Eignungstests oder Berufserfahrung.
"Die überragende Bedeutung der Abiturnote musste zurückgestutzt werden, und das war richtig", sagt Martina Kadmon, Dekanin der Medizinischen Fakultät Augsburg. Kadmon ist auch Präsidentin des Medizinischen Fakultätentages (MFT), ein Zusammenschluss aller medizinischen Fakultäten in Deutschland, der die gemeinsamen Interessen in Lehre, Forschung und Ausbildung vertritt.
"Die Plätze im Ausland sind längst ein fester Bestandteil
der deutschen Ärzteausbildung geworden."
Pascal Lemmer, Präsident der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd), warnt dagegen: "Die Bewerberauswahl ist alles andere als perfekt. Dem Abitur wird immer noch viel Bedeutung zugemessen." Denn die Abinote, sagt Lemmer, könne zwar vorhersagen, wie gut jemand in Prüfungen abschneidet – jedoch nicht, ob sie oder er eine fähige Ärztin oder ein fähiger Arzt werden.
Private Hochschulen bilden Ärzte aus
Immer mehr Bewerber weichen daher auf private Hochschulen aus – in Brandenburg, Potsdam, Hamburg, Berlin – oder gehen ins Ausland. Mindestens 9100 Deutsche studieren bereits Humanmedizin außerhalb des Landes, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) ermittelt hat. "Das sind nicht ein paar Hundert, das sind Tausende jedes Jahr. Diese Plätze im Ausland sind längst ein fester Bestandteil der deutschen Ärzteausbildung geworden", betont Cort-Denis Hachmeister vom CHE. Zugleich kritisiert er: "In der politischen Debatte spielt das fast keine Rolle."
"Das Problem ist ein Verteilungsproblem."
In Berlin zeigt sich der Trend besonders deutlich: Während die staatliche Charité seit Jahren stabil um die 740 Plätze pro Jahr vergibt, hat die private Medical School Berlin die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger seit 2019 auf inzwischen über 300 pro Jahr gesteigert. 2024 begannen damit insgesamt 1068 junge Menschen ein Medizinstudium in der Hauptstadt – so viele wie nie zuvor, mehr als ein Drittel davon privat.
Doch ist das Ausweichen ins Ausland und in Privathochschulen auch ein Zeichen dafür, dass insgesamt ein Ärztemangel herrscht, wie ihn etwa Ex-Minister Lauterbach einst beklagte? Die bundesweite Zahl der Ärztinnen und Ärzte steigt seit Jahren, Ende 2024 waren es 437.000 Berufstätige, die Ärztedichte im Verhältnis zur Einwohnerzahl liegt weltweit unter den Top fünf.
"Wir haben eigentlich ausreichend Studienplätze", sagt Studierendenvertreter Lemmer. "Das Problem ist ein Verteilungsproblem." Eine Landarztpraxis eröffnen nämlich vor allem die Menschen, die auch auf dem Land groß geworden sind. Die aber studieren seltener Medizin, schon allein, weil es in ihrem Einzugsbereich oft keine größere Uni mit medizinischer Fakultät gibt. Und von denen, die für ein Medizinstudium vom Land in die Stadt wechseln, kommen etliche auf den Geschmack und wollen nicht mehr zurück aufs Land.
Niemand hat den Überblick
Die Medizin-Dekanin Kadmon sieht es ähnlich: "Es gibt keinen generellen Mangel an Studienplätzen, sondern ein Problem der Steuerung und der Verteilung." Das Bundesgesundheitsministerium wiederum räumt ein, dass niemand wirklich den Überblick hat: "Eine bundesländerübergreifende Studienplatzbedarfsplanung gibt es bislang nicht." Die Zahl der Plätze sei Ländersache, das Ministerium verfolge die Entwicklung lediglich "aufmerksam".
Wie groß die Datenlücken sind, zeigt beispielhaft der Blick nach Berlin. "Hierzu liegen der Senatsverwaltung keine validen Daten vor", heißt es dort etwa auf die Frage, wie viele Ärztinnen und Ärzte mit ausländischem Abschluss in der Hauptstadt tatsächlich arbeiten. Zwar wurden 2024 insgesamt 421 Approbationen aufgrund ausländischer Abschlüsse erteilt – knapp die Hälfte davon an Ärztinnen und Ärzte aus Drittstaaten –, doch ob und wie viele dieser Medizinerinnen und Mediziner danach auch in Berlin tätig sind, ist unklar.
Klar ist: In vielen ländlichen Regionen herrscht tatsächlich Knappheit. Viele Länder versuchen gegenzusteuern – mit einer Landarztquote für Studienbewerber, die sich vertraglich dazu verpflichten, später mehrere Jahre als Arzt in Mangelregionen zu arbeiten.
Zweifel an der Landarztquote
Aber was genau diese noch recht neue Quote bewirkt, kann ebenfalls bislang keiner so genau sagen. "Wir wissen nicht, ob es funktioniert", sagt MFT-Präsidentin Kadmon. "Wenn man es tut, muss man es begleiten. Und das Outcome-Parameter kann nicht sein: Die Studienplätze sind ausgelastet." Denn auch wenn die Idee der Landarztquote naheliegend und plausibel klingt, so wäre zum Beispiel denkbar, dass angehende Landärzte häufiger als andere das Studium abbrechen. Oder dass sie nur die Mindestdauer auf dem Land bleiben und dann doch in die Städte zurückkehren.
Weshalb der MFT jüngst in einem Positionspapier forderte, bestehende Sonderquoten erst wissenschaftlich zu evaluieren, bevor neue eingeführt werden: "Immer kleinteiligere Vorabquoten mit spezifischen Auswahlverfahren erzeugen hohen administrativen Aufwand, ohne dass belastbare Daten zu ihrer Wirksamkeit vorliegen."
Anstatt über mehr Studienplätze oder neue Quoten zu diskutieren, möchte auch CHE-Experte Hachmeister die Debatte gern auf Anderes lenken. "Entscheidend sind gute Rahmenbedingungen für Praxen und Anreize, überhaupt als Arzt zu arbeiten und nicht etwas anderes, weil es weniger stressig ist." Ein zweiter Hebel könnte die schnellere Anerkennung ausländischer Abschlüsse sein. Ein Gesetzentwurf, der genau dies erreichen soll, ging gerade durchs Kabinett.
Was taugt das italienische Modell?
Für junge Menschen, die gern Medizin studieren wollen, bleibt die Lage indes zwiespältig. Ohne Spitzennoten bleiben oft nur ein hervorragender Medizinertest, private Hochschulen – oder der Weg ins Ausland. Für viele klingt da die italienische Reform verlockend: Dem Modell zufolge können sich die Studierenden frei einschreiben, müssen im ersten Semester drei Grundkurse aus den Biowissenschaften belegen – und dann erst die eigentliche Auswahlprüfung bestehen. Wer scheitert, wechselt in ein anderes Fach, darf die Credits aber behalten. Wiederholen lässt sich das Ganze bis zu dreimal.
"Man gibt den Leuten eine Chance", kommentiert Denis-Cort Hachmeister. Allerdings: "Wenn da alle anfangen und Lebenszeit investieren und dann wieder rausfliegen, ist das sehr ineffizient." Pascal Lemmer warnt, eine solche Reform wäre "eine Rolle rückwärts, weil sie genau den Zielen des Masterplans widerspräche, ärztlich-interpersonelle Kompetenzen zu stärken. Wenn nur die naturwissenschaftlich Stärksten durchkommen, hat man am Ende die Falschen drin."
Der Masterplan Medizinstudium, vor einigen Jahren von Bund und Ländern beschlossen, sollte den Praxisbezug in der Ärzteausbildung vom ersten Semester an sicherstellen. Naturwissenschaften seien dabei zwar die Basis, "aber eben nicht alles, was wir später als Ärztinnen und Ärzte brauchen", sagt auch Dekanin Kadmon und warnt mit Blick auf das italienische Modell: "Diejenigen, die nicht in Naturwissenschaften sehr gut orientiert sind, würden rausfallen." So erhöht mehr Offenheit beim Zugang zwar den Druck auf die Hochschulen, führt aber womöglich gar nicht dazu, dass am Ende mehr Ärzte dabei herauskommen. Und anstatt mehr soziale Öffnung zu erreichen, könnte die soziale Auslese noch härter werden.
Die italienische Regierung wollte zur Finanzierung ihres Modells allein für das Studienjahr 2025/2026 50 Millionen Euro bereitstellen, um bis zu 3.000 zusätzliche Plätze zu schaffen, berichtete RAI. Doch die Hochschulen warnten, sie sie hätten weder das Personal noch die Infrastruktur, um den zusätzlichen Studierendenstrom zu bewältigen. Hinzu kommt laut Ärzteverband Anaao-Assomed: Die Regierung die Studienplätze erhöhen, aber die Kapazitäten in der anschließenden Facharztausbildung blieben unverändert.
Eine Lektion inmitten des Fachkräftemangels über die Medizin hinaus: Offene Türen allein helfen nicht, wenn Studienplatzkapazitäten, Praxisbezug und Arbeitsbedingungen nicht mitwachsen. Am Ende entscheidet, wie attraktiv der Arztberuf ist – und ob die Gesellschaft bereit ist, Ärztinnen und Ärzte dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden.
Dieser Artikel erschien in kürzerer Fassung zuerst im Tagesspiegel.
Kommentare
#1 - Offene Türen...
Das italienische Modell ist jetzt nicht so furchtbar neu, so etwas gibt es in Frankreich schon lange. Jede/r darf ein Medizinstudium beginnen, muss aber nach dem ersten Theoriejahr eine sehr harte Prüfung schaffen, die 80 Prozent nicht bestehen. Ich würde davon ausgehen, dass die erfolgreichen Kandidat/innen zum ganz großen Teil die Abiturbesten sind (oder "Hochschulzugangsprüfungbesten"). Auf die hiesigen Verhältnisse übertragen, würde ich mal wild vermuten, dass eine solche Prüfung ungefähr die bestehen würden, die jetzt mit der Kombination "sehr gutes Abitur plus sehr gute Medizinertestergebnisse" einen Studienplatz an einer staatlichen deutschen Universität erhalten. De facto würde sich nicht viel ändern, aber man würde ein neues Geschäftsfeld eröffnen: kostenpflichtige Repetitiorien für diese Prüfung.
Es gibt aber einen Elefanten im Raum bei der Ärzteversorgung, und zwar die hohe Teilzeitquote. https://www.pharmazeutische-zeitung.de/teilzeit-unter-aerzten-immer-beliebter-158616/ Wenn 43 Prozent der angestellten Hausärzt*innen nur im Durchschnitt 21 Stunden in der Woche arbeiten, ist klar, dass die Kapazität fehlt...
#2 - Keine neue Idee
Es ist sehr interessant, das Italien jetzt auch diesen Weg geht, neu ist die Idee keinesfalls. Unter dem Namen PACES gibt es das System in Frankreich seit 2010 (auch davor hatte Frankreich für Medizin ein ähnliches System, das PACES umfasst jetzt auch Zahnmedizin, Geburtsheilkunde und Pharmazie). Vor- und Nachteile haben sich in Frankreich gut etabliert und werden auch durchaus kontrovers diskutiert. Mir sind auch Menschen bekannt, die als Deutsche mit einem Deutsch-Französischen Doppelabitur das PACES gewagt haben, weil es einfacher war, überhaupt erst ins Studium zu kommen als in Deutschland.
#3 - Österreich
Interessant ist der alternative Weg in Österreich. Die Abschlussnote der Matura spielt hier keine Rolle, ein NC ist unbekannt. In Medizin ist aber der MedAT zu absolvieren. 2025 haben fast 13.000 Personen für 1.900 Studienplätze teilgenommen. Es gibt dabei zwei Phänomene: die Zahl deutscher Studierender ist hoch, es gibt eine Quote von max 20% für EU-Ausländer, die in Österreich Medizin studierenden wollen, sie müssen jedenfalls auch den MedAT machen. Das andere Phänomen: wie in Deutschland nimmt die Zahl privater, kostenpflichtiger (ca 150.000 € für Bachelor + Master) Medizinhochschulen zu, aktuell sind es ca 600 Studienplätze bei diesen pro Jahr.
Und das Ergebnis: es fehlen überall Mediziner auf den Kassenstellen, viele wandern nach dem Abschluss ins Ausland ab, auch die Österreicher. Die Idee von "Landarzt-Verpflichtungen" gibt es, wird aber kaum wirklich umgesetzt.

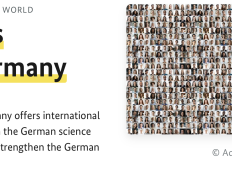






Neuen Kommentar hinzufügen