Öffentlich, engagiert, politisch – und ein Problem?
In Berlin wird an den Unis oft um den Chefposten gerungen, wie man es sonst aus der Politik kennt. Ob das exzellente Bewerber abhält oder im Gegenteil ein Fortschritt ist: Darüber gehen die Meinungen auseinander.

Sechs Bewerberinnen und Bewerber, vier Jahre Amtszeit: Wahl an der TU Berlin. Foto: Fridolin freudenfett (Peter Kuley), CC BY-SA 3.0.
AN DER TU BERLIN begann der Wahlkampf Wochen, bevor überhaupt feststeht, wer ins Rennen gehen darf. Mitte November erst bestimmen Akademischer Senat und Kuratorium offiziell über das Kandidatenfeld. Doch die Namen mehrerer Bewerber sind längst bekannt.
Es handelt sich um die amtierende Präsidentin Geraldine Rauch, die Vizepräsidentin Fatma Deniz, die Regelungstechnikerin Steffi Knorn – und den externen Bewerber Tim Stuchtey, einst Referent des TU-Präsidenten, heute Direktor eines sicherheitspolitischen Thinktanks. Hinzu kommen zwei weitere Externe, die ihre Namen bislang nicht öffentlich machen wollen. Einer davon soll Prorektor einer Universität in Nordrhein-Westfalen sein.
Derweil präsentieren sich die bekannten Bewerber bereits auf dem eigens eingerichteten TU-Wahlportal, sie gehen auf Tour durch die Uni, es gibt Town-Hall-Meetings. Im November lädt die Uni dann zur „Wahlarena“ ins Audimax: Wahlkampf als Event. Öffentlich, engagiert, politisch. Und genau das ist das Problem – oder, je nach Blickwinkel, der Fortschritt.
"Mit Wahlportal und Wahlarena kommen wir dem sehr hohen und sehr berechtigten Informationsbedürfnis der Universität entgegen, zumal auch die Medien bereits jetzt berichten", sagt TU-Sprecherin Steffi Terp. Sie spricht von einer "Professionalisierung in der Ansprache der Uni-Öffentlichkeit".
Die Öffentlichkeit aushalten?
Doch der Personalberater Norbert Sack, der häufig von Unis mit der Kandidatensuche beauftragt wird, warnt vor der Kehrseite: "Für viele Hochkaräter ist Vertraulichkeit von höchster Bedeutung". Viele externe Kandidaten, sagt Sack, schreckten vor Verfahren wie denen an der TU Berlin zurück – zu riskant für die eigene Karriere. "Wenn die Namen zu früh in der Öffentlichkeit auftauchen und man dann nicht gewählt wird, droht man zum berüchtigten Wanderpokal zu werden."
Ein Recht auf Öffentlichkeit gebe es bei Uniwahlen verfassungsrechtlich nicht, sagt der Erlanger Hochschulrechtler Max-Emanuel Geis. Das sei eine politische Entscheidung. Aber: "Wer sie nicht aushält, ist vielleicht auch nicht geeignet für das Amt."
Alle Bewerber, auch die sich noch nicht öffentlich äußern, hätten gleichberechtigten Zugang zu den an der Wahl beteiligten Gremien, betont TU-Sprecherin Terp.
Dass die Bewerbernamen wie an der TU so lange vor der eigentlichen Kandidatenkür kursieren, ist bundesweit die Ausnahme. Meist tagen zunächst Findungskommissionen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sie prüfen die Kandidatenlage in vertraulichen Gesprächen, sie führen Hearings, um schließlich eine verbindliche Wahlliste vorzulegen. Nicht selten steht dann da sogar nur noch ein Name drauf – der einzige, der öffentlich wird.
Auch an der TU gab es eine Findungskommission, doch Akademischer Senat und Kuratorium sind nicht an deren Bewerberliste gebunden. Sie können fast bis zuletzt weitere Personen nominieren. Eine ähnliche Regelung existiert an der FU Berlin, wo Ende Januar 2026 Präsidentenwahlen stattfinden und gerade die Bewerbungsfrist endete. Auch dort hat die Findungskommission nur beratende Funktion. Akademischer Senat und Kuratorium können von der Ausschreibung unabhängig noch bis 10. Dezember Wahlvorschläge beschließen.
Media begleitete Zweikämpfe
Bei den letzten Wahlen an den Berliner Universitäten waren es, manchmal mit, manchmal ohne Findungskommissionen, immer medial stark begleitete Zweikämpfe. An der FU setzte sich 2022 Amtsinhaber Günter M. Ziegler gegen die Kölner Prorektorin Beatrix Busse durch.
An der HU nominierte das Kuratorium Julia von Blumenthal und den damaligen Gießener Unipräsidenten Joybrato Mukherjee – der aber schon vor der Wahl zurückzog – mit der Begründung, dass das Präsidium im Falle seiner Wahl nur mit Männern besetzt gewesen wäre. Mukherjee wurde später Rektor der Universität zu Köln. An der TU gewann Geraldine Rauch 2022 als externe Kandidatin gegen den langjährigen Amtsinhaber Christian Thomsen.
Im Berliner Hochschulgesetz ist im Gegensatz zu vielen Landesgesetzen die Rolle und Zusammensetzung der Findungskommissionen und die Verbindlichkeit ihrer Vorschläge nicht geregelt.
An TU und FU, wo ebenfalls bald gewählt wird, kommt eine Besonderheit dazu: Hier dauern die Amtszeiten der Präsidenten nur vier Jahre. Auch das ist im bundesweiten Vergleich außergewöhnlich, anderswo sind fünf, oft sogar sechs Jahre die Regel. Zwar nennt auch das Berliner Hochschulgesetz sechs als Norm, lässt aber vier als Untergrenze zu.
Kurze Amtszeiten in Berlin
"Vier Jahre sind zu kurz, damit aus einer Idee eine Maßnahme und eine Wirkung wird", sagt Sack. "Dafür braucht man mindestens sechs." Kurze Amtszeiten bedeuten: häufiger Wahlkampf, geringere Planungssicherheit. Und für Kritiker ein weiteres Unruheelement in ohnehin hochschulpolitisch aufgeheizten Zeiten.
An der TU Berlin aber ist das Wahlprozedere längst Teil der Universitätskultur. Die ebenfalls mit hoher Öffentlichkeit und Aufregung geführte Grundordnungsdebatte drehte sich zuletzt weniger um Amtszeitlängen oder die Rolle von Findungskommissionen, sondern vor allem um die "Viertelparität" bei der Präsidentenwahl: die gleichberechtigte Stimmenverteilung zwischen Professor:innen, Studierenden, wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeitenden. Ein Schritt, der von der Senatsverwaltung zunächst aus verfassungsrechtlichen Gründen gestoppt wurde.
Dass die Präsident:innenwahl an der TU nun unter besonderer Beobachtung steht, liegt auch an der Person der Amtsinhaberin. Geraldine Rauch war im vergangenen Jahr wegen "Likes" auf Posts zum Gaza-Konflikt in die Schlagzeilen geraten. Die Empörung war heftig – vom Zentralrat der Juden bis zur Berliner CDU –, der Akademische Senat gespalten, Rauch lehnte Rücktrittsforderungen ab.
In der Debatte um die Bedrohung von Demokratie und Wissenschaftsfreiheit von Rechtsaußen engagierte sich Rauch außerordentlich, was ihr viel Zustimmung, aber auch Kritik an ihrem Rollenverständnis als Präsidentin einbrachte. Neulich beschwerte sie sich über eine studentische Veranstaltung zum Thema Islamismus und sah "antimuslimische Tendenzen".
Gegenwind und interne Gräben
Eine Präsidentin im Gegenwind, interne Gräben, ein öffentlich geführter Wahlkampf: So wird die Wahl der Hochschulleitung an der TU zu einem Brennglas für die Spannungen, die viele Hochschulen derzeit durchziehen – zwischen innerer Freiheit und äußerer Erwartung, zwischen Diskurs und Dauererregung.
"Es gibt in solchen Verfahren immer drei Zielideale", sagt Personalberater Sack: "die bestmögliche Person, ein transparenter und partizipativer Prozess und ein rechtlich sauberes Verfahren." Nur: Diese Ziele beißen sich mitunter. Je mehr Transparenz, desto höher das Risiko von Lagerbildung, von medialem Druck und verbrannten Namen. Je mehr Vertraulichkeit, desto geringer die Mitwirkung und die öffentliche Legitimation.
Annette Fugmann-Heesing, frühere SPD-Politikerin und langjährige Hochschulratsvorsitzende an der Universität Bielefeld, plädiert daher für eine klare Trennung: "In der ersten Phase absolute Vertraulichkeit, sonst bekommen Sie keine hochklassigen Bewerbungen von draußen. In der zweiten Phase, wenn die Liste steht, volle Transparenz zu den Personen auf der Liste."
An der TU Berlin aber verschmelzen diese Phasen. Und so wird dort in diesen Wochen über alles diskutiert – über Kandidaturen, Macht, Haltung und Führungskultur. Nur nicht über das, was das Berliner Hochschulgesetz eigentlich damit zu tun hat, dass an Berliner Hochschulen oft so viel Unruhe herrscht.
Dieser Artikel erschien zuerst im Tagesspiegel.
Kommentare
#1 - Universitätspräsidenten
"Geraldine Rauch war im vergangenen Jahr wegen "Likes" auf Posts zum Gaza-Konflikt in die Schlagzeilen geraten."
Sie ist offenbar der Meinung, eine Hochschulleitung soll oder darf sich öffentlich zu allgemein-politischen Konflikten äußern. Ich denke, das ist ein Irrtum. Äußerungen zur Hochschulpolitik sind willkommen, aber auch nur, wenn sie nicht einfach (als solche ungekennzeichnete) persönliche Meinungen der Frau Präsidentin sind.
Hier hat sie mal wieder gezeigt, dass sie ihre Kompetenzen nach Belieben ausdehnt und meint, eine Art von inhaltlicher Aufsicht bei einem Streit um Worte wie "politischer Islam" und "Islamismus" üben zu sollen, so als sei sie eine Autorität bei dem Thema:
https://www.tagesspiegel.de/wissen/wegen-einladung-eines-judisch-kurdischen-verein-hochschulgruppen-an-der-tu-streiten-sich-uber-islamismus-14594207.html
Die beanstandete Broschüre kann man von dort herunterladen, es ist empfehlenswert mal hineinzuschauen, besonders der Abschnitt "Die Entrechtung der Frau als islamistisches Kernanliegen". Natürlich ist da manches den islamischen Autoritäten gar nicht recht, weil über Unterdrückung von Frauen und "queer" mit extremer Missachtung der Menschenrechte in der islamischen Welt berichtet wird, aber welche Sonderrechte haben denn bitte islamische Autoritäten in unserem Land? Wieso dürfen auf einer Diskussionsveranstaltung keine "islamfeindlichen Tendenzen" geäußert werden, wohl aber "katholizismusfeindliche Tendenzen", "kommunismusfeindliche Tendenzen", "israelfeindliche Tendenzen" usw.? Damit werden ja nicht Muslims, Katholiken, Kommunisten, Israelis usw. als Menschen beleidigt oder diskriminiert. Es geht um die Systeme, um Macht und Herrschaftsstrukturen.
Ein kontroverser Disput ist nicht möglich, ohne dass im Sinne einer vagen "Tendenz" auch mal das gesagt wird, was der jeweils anderen Seite gegen den Strich geht. Der Maßstab sind immer noch die Regeln des Grundgesetzes. Was verfassungsfeindlich (z.B. extremistisch) ist, das entscheidet das Bundesverfassungsgericht nach Vorarbeit des Verfassungsschutzes, aber nicht einzelne Interessengruppen (wenn z.B. irgendwelche Gruppen etwas pauschal und lautstark als "x-phob" bezeichnen, so als sei das schon synonym mit "darf nicht gesagt werden") und auch nicht irgendwelche anonymen "Antidiskriminierungsakteure", auf die sich Frau Rauch beruft, erst recht nicht ein ominöses "Studierendenkollektiv für Palästina".
Wenn es bei der Besetzung von Präsidentenposten von Universitäten bald auf ähnliche allgemein-politische Bekenntnisse oder Parteipolitik ankommt, wenn das so ähnlich wird wie bei den Intendantenposten des ÖRR, wenn möglicherweise noch einseitige Haltungen zu Konflikten in der weiten Welt eine Rolle spielen, dann ist das das Ende einer unabhängigen Universität als wissenschaftliche Institution. Sie wird dann eingegliedert in eine Hierarchie, ähnlich einem Ministerium, und es wird "top-down" verkündet, was als richtig zu gelten hat. Davor sollte man dringend warnen. Wir kennen das aus Diktaturen.

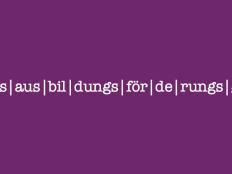






Neuen Kommentar hinzufügen