Der Zulassungsskandal an US-Eliteunis zeigt auch: Wer die Stärke des amerikanischen Hochschulsystems begreifen möchte, sollte jenseits von Harvard und & Co blicken. Von Jeffrey Peck.
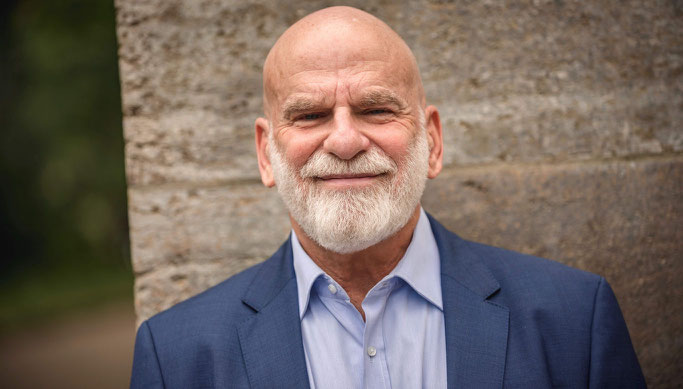
Jeffrey Peck. Foto: privat.
Der Skandal über die bevorzugte Zulassung von reichen, jungen Leuten an US-Eliteuniversitäten, teilweise mit Celebrity-Eltern, offenbart eine sehr negative Seite des amerikanischen Hochschulsystems. Zugleich sagt er viel über das Land im Allgemeinen und insbesondere über die enge Verbindung zwischen Geld und Hochschulbildung. Die sehr hohen Studiengebühren in den USA sind in der kritischen Debatte darüber zu Recht in den Mittelpunkt gerückt.
Gleichzeitig lässt sich anhand der diesbezüglich in Deutschland geführten Diskussion ablesen, dass viele Deutsche das US-Bildungssystem nicht so gut kennen, wie sie vielleicht denken. Dass sie zumindest aber nicht ausreichend differenzieren. Zum einen ist da die aus meiner Sicht zu starke Fokussierung auf Eliteuniversitäten. Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Die scharfe Kritik an solchen Einrichtungen ist berechtigt, keine Frage, weil Misstände angesprochen werden müssen, um sie zu ändern.
Aber wichtiger noch als die Frage nach den Eliten und ihrer Reproduktion mithilfe des Bildungssystems ist zum anderen das problematische Zusammenspiel von Geld und Geschäftemachen, vor allem in Bezug auf die Alumni-Arbeit und dem, in den USA so beliebten College-Sport. So kann es zum Beispiel passieren, dass ein hervorragender Sportler nicht den akademischen Anforderungen des Studiums gewachsen ist. Ich spreche an dieser Stelle auch aus meinen eigenen Erfahrungen von über zehn Jahren als Professor an der Georgetown University, wo jetzt sogar mit Bestechung vorgebliche sportliche Fähigkeiten den Weg in diese Prestigeuniversität ebnen sollten.
JEFFREY D. PECK war über viele Jahre Wissenschaftsmanager in den USA. Jetzt lebt er in Deutschland und arbeitet als Berater im Hochschulbereich. Über seine Erfahrungen und Einsichten schreibt er einmal im Monat hier im Blog.
Mir liegt jedoch viel daran, den Lesern in Deutschland auch ein anderes Bild von US-Bildungsinstitutionen zu vermitteln, das genauso der Realität entspricht. Ein Bild, für das die großen öffentlichen US-Universitäten stehen, getragen von den jeweiligen Bundesstaaten, die University of California zum Beispiel, die University of Michigan oder die University of Wisconsin.
Ich hatte in meiner Karriere das Glück, als Professor und Dekan auch im größten öffentlichen urbanen Universitätssystem der USA, an der City University of New York (CUNY), zu arbeiten. Mit 25 Colleges (einige sind eigentlich eigene Universitäten), fast 300 000 Studierenden und 6700 Vollzeit-Fakultätsmitgliedern hat diese historische Institution einen ganz besonderen Platz in der amerikanischen Hochschullandschaft. Aber es ist nicht nur CUNYs Rolle für die Stadt New York und die Ausbildung seiner Bürger seit seiner Gründung im Jahr 1847, sondern mir geht es auch um die Möglichkeiten, die diese Hochschule für Einwanderer, ihre Kinder und Arbeiterkinder im Allgemeinen bietet. Und das seit über 100 Jahren. Die Studienanfänger der CUNY waren oft die Ersten in ihrer Familie, die an eine Hochschule gingen. Sie konnten nicht auf reiche Eltern zählen, sondern sie haben sich allein durch Fleiß, Mühe und Arbeit ihren Studienplatz verdient. CUNY wurde damals sogar "the Harvard of the proletariat" genannt.
Ich weiß, dass dies "typisch amerikanisch" klingt, nach dem oft zu Unrecht beschworenen "Land der unbegrenzten Möglichkeiten". Aber für Menschen, die keine andere Chance gehabt hätten zu studieren, erfüllte und erfüllt die CUNY immer noch den amerikanischen Traum. Meinen Zynismus über die Pervertierung des amerikanischen Traumes reserviere ich mir für die Reichen und ihre oben erwähnten ganz eigenen Bemühungen um einen Studienplatz.
Über ein Jahrhundert lang war das Studium an CUNY komplett kostenfrei, bis 1976 gab es keinerlei Studiengebühren; jetzt liegen diese bei ungefähr 7000 Dollar pro Jahr für Studierende aus dem Bundesstaat New York. Viele zahlen weiterhin weniger oder gar nichts, weil sie Stipendien erhalten. Viele wohnen noch bei ihren Eltern und arbeiten nebenbei, manche haben sogar mehrere Jobs, um ihre Lebenshaltungskosten zu bezahlen.
Im Vergleich zu Deutschland sind 7000 Dollar Studiengebühren natürlich immer noch hoch. Im Vergleich zu Ivy League Elite-Colleges oder Universitäten wie Stanford, Georgetown, Yale oder USC (Einrichtungen, die in den aktuellen Skandal involviert sind) fallen sie dagegen fast schon lächerlich gering aus. Gewöhnlich fast 50.000 Dollar pro Jahr sind dort zu bezahlen, hinzukommen room and board, also Wohnen und Essen, womit die Eltern der Studierenden zwischen 60.000 und 70.000 Dollar pro Jahr hinblättern müssen. Und das mindestens vier Jahre lang.
Weil aber bei den meisten Studierenden die Eltern so viel Geld nicht zur Verfügung haben, müssen sie Kredite, student loans, aufnehmen und sind - wie eine Freundin von mir - noch am Abzahlen ihrer Studiendarlehen, wenn sie 50. Geburtstag feiern. Kein tolles Bild!
Die CUNY dagegen verlassen 8 von 10 Absolventen schuldenfrei. Welch ein Einstieg in ein ganz anderes Leben, das sie als Kinder aus der Bronx oder mit Eltern aus Vietnam, Jamaika oder Russland sonst erwartet hätte. Studien und Rankings belegen, dass die Meisten den sozialen Aufstieg in die middle class dann tatsächlich schaffen. Was auch von ihren Eltern als persönlicher Erfolg erlebt wird. Viele CUNY-Absolventen arbeiten später in corporations, Banken und der Industrie, und sie sind glücklich, solche Arbeitsstellen zu haben. Sie können, wie man sagt, in the boardroom rather then in the backroom ihre Leistung unter Beweis stellen. Wieder der amerikanische Traum, der Traum des Kapitalismus? Gewiss!
Weil es eben weniger eine generelle Kritik eines vermeintlichen Kapitalismus im US-Bildungswesen ist, die ich für angebracht halte, sondern weil ich zum genauen Hinschauen anregen möchte. Es gibt eben auch die public universities wie CUNY, die es immer noch schaffen, eine sehr gute Ausbildung zu vermitteln und ein anderes Ethos zu verfolgen. Natürlich sind die public universities genau wie die staatlichen Hochschulen in Deutschland abhängig von der Finanzierung durch den Staat, und diese Finanzierung fällt immer knapper aus. Weshalb das Fundraising eine immer wichtigere – auch problematische – Rolle spielt. Wie ich in meinem Blogbeitrag "Money makes the world go around" (08.05.18) schrieb, hat dieses Geldeinsammeln allerdings auch positive Auswirkungen.
Eine der wichtigsten Aspekte der CUNY story ist, dass es die City University of New York war, an der viele jüdische Immigranten aus Osteuropa und ihre Kinder nach dem 1. Weltkrieg studieren konnten, weil viele Universitäten, auch die der Ivy-League, damals Quoten für Juden hatten. Auch heute noch ist die CUNY für viele Erstsemester die einzige Möglichkeit auf ein Studium, nur sehen die Studierenden heute anders aus als vor 100 Jahren. Nie waren sie bunter und gemischter als heute: Diversität ist hier nun alltägliche Normalität. Viele der Absolventen waren in ihrem weiteren Leben sehr erfolgreich. Sie haben das Ethos vom "giving back" im besten Sinne des Wortes in Millionen Dollars von Spenden übersetzt. Viele CUNY-Gebäude und Stipendien tragen ihren Namen und ehren ihre Leistungen und ihr Andenken.
Die amerikanische Bildungslandschaft ist, so ist hoffentlich deutlich geworden, vielfältiger und bunter, als es von Europa aus manchmal aussieht. Wenn man das deutsche und das amerikanische System vergleicht, wäre es deshalb aus meiner Sicht sinnvoller, öffentliche Hochschulen wie die CUNY zu betrachten, die ähnlichere Budgets und Studierendenschaften, vergleichbare Vorgaben und Ziele haben wie ihre deutschen Konterparts. Deutsche Universitäten werden wahrscheinlich niemals Ebenbilder von Harvard oder Princeton sein, allein schon wegen des Geldmangels. Und dieser Satz lässt sich auch positiv wenden:
An deutschen Universitäten wird vermutlich auch nie passieren, was sich mit dem, in den USA gerade aufgedeckten Skandal vergleichen ließe. Gott sei Dank! Trotzdem bleibt Geld ein zentraler Faktor, egal wo. Aber wie wir und die Hochschulen über Geld sprechen, schreiben und vor allem welche Bedeutung sie dem Geld in ihren strategischen Entscheidungen geben, ist eine andere Frage und liegt in unser aller Verantwortung.
Kommentar schreiben
Anonym (Mittwoch, 03 April 2019 16:35)
Auch wenn ich vielem in ihrem Beitrag zustimmen, so darf man doch nicht alles in einen Topf werfen: Dass private Elite-Einrichtungen horrende Studiengebühren verlangen und ihre Studierende in die Verschuldung entlassen stimmt schlichtweg nicht. Harvard, Yale, Stanford usf. verlangen nur von Kindern wohlhabender Eltern Gebühren und ermöglichen jedem, der aus einem Haushalt mit geringem Einkommen kommt, ein kostenfreies Studium, während viele der guten, staatlichen Universitäten (z.B. UCLA) dies nicht ermöglichen können. Dass viele Studierende es gar nicht erst nach Harvard, Yale und Co. schaffen ist dann ein anderes Problem.