Viele Hochschulen in Deutschland ringen um die "richtige Governance". Hinter den Auseinandersetzungen verbergen sich zwei sehr unterschiedliche Verständnisse wissenschaftlicher Produktion. Beide haben ihre Berechtigung, müssen sich aber auch gegenseitig anerkennen. Ein Gastbeitrag von Carola Jungwirth.
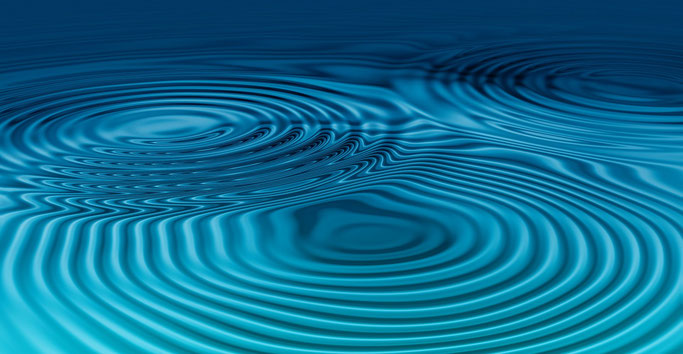
Foto: Gerd Altmann / pixabay - cco.
FÜR DEUTSCHE UNIVERSITÄTEN gilt das Prinzip der Freiheit von Forschung und Lehre eines jeden Professors und einer jeden Professorin. Sie ist grundgesetzlich gesichert und wirtschaftlich mit dem Beamtenstatus für Hochschullehrerinnen und -lehrer verbunden. Beide Faktoren macht die "kreative Erneuerung" möglich, für die die Wissenschaft in Deutschland steht.
Obwohl damit die Eckpfeiler der Führung an Hochschulen feststehen, entsteht Streit: Wie stark darf oder muss eine Hochschulleitung über die strategische Positionierung der Hochschule und damit über die Verteilung von Ressourcen entscheiden können? Grob lassen sich zwei Seiten in diesem Streit unterscheiden. Die einen lehnen Entscheidungsrechte der Hochschulleitung ganz grundsätzlich ab. Instrumente einer optimierten Ressourcenallokation erscheinen ihnen nicht notwendig. Die anderen fordern starke Entscheidungsrechte für die Hochschulleitung. Sie sehen diese Rechte als Voraussetzung für eine leistungsfähige und damit konkurrenzfähige Universität.
Die Produktionssysteme
der Wissenschaft
Die Unterschiede in den Perspektiven resultieren ganz wesentlich aus den unterschiedlichen Produktionssystemen, in denen Forschung und Lehre je nach Disziplin betrieben werden. Zwei Merkmale unterscheiden diese Systeme fundamental: Erstens kommt es darauf an, ob die wissenschaftlichen Ergebnisse arbeitsteilig oder individualistisch erzielt werden. Arbeitsteilig ist ein Produktionssystem, wenn Forschung vorrangig im Team beziehungsweise mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrieben wird. Individualistisch ist ein System, wenn eine Person alleine wissenschaftlich Forschungsergebnisse produzieren kann.
Zweitens ist die Abhängigkeit von Drittmitteln entscheidend. Drittmittelabhängig ist ein Produktionssystem, wenn die Grundfinanzierung durch die Hochschule durch externe Mittel ergänzt werden muss, damit wissenschaftliche Ergebnisse produziert werden können. Drittmittelunabhängig ist ein Produktionssystem, wenn die Grundfinanzierung dazu ausreicht.

Carola Jungwirth, 53, ist Wirtschaftswissenschaftlerin und bis 31. März 2020 Präsidentin der Universität Passau. Außerdem ist sie HRK-Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Foto: Universität Passau.
Stellen wir uns für das Bild eines arbeitsteiligen und drittmittelabhängigen Produktionssystems eine Biologin vor. Sie forscht in einem 140 Quadratmeter großen Labor zusammen mit ihren Doktorandinnen und Mitarbeitern. Um die Forschung im Labor zielgerichtet vorantreiben zu können, verteilt sie die Aufgaben und setzt auf die Spezialisierung der einzelnen Teammitglieder. Arbeitsteiligkeit ist in der Regel der Tatsache geschuldet, dass wettbewerbsfähige wissenschaftliche Erkenntnis in Disziplinen wie der Biologie nur noch in wenigen Fällen von einer Person alleine hervorgebracht werden kann. Daraus folgt direkt die Drittmittelabhängigkeit.
Denn die Grundfinanzierung der Hochschule reicht für ein funktionsfähiges Team selten aus.
Die Arbeitsteiligkeit erfordert Transparenz und Qualitätssicherung im gesamten Prozess. Vor der Synthese der Teilergebnisse sind qualitätssichernde Verfahren notwendig. Ein Fehler in einem Teilschritt verdirbt das Gesamtergebnis. Die Drittmittelabhängigkeit verschärft das Erfordernis von Transparenz und Qualitätssicherung weiter. Der Drittmittelgeber knüpft seine Zusage an eine genaue – und damit transparente – Leistungsbeschreibung und eine effektive Qualitätssicherung durch die Hochschule. Die systematische Bereitstellung und Dokumentation von Transparenz und Qualitätssicherung fordern von der Hochschule eine erhebliche Professionalisierung ab. Antragsteller und Hochschule sind daher in hohem Maß aufeinander angewiesen, um die benötigten Drittmittel ins Haus holen zu können.
Diesem arbeitsteiligen und drittmittelabhängigen Produktionssystem steht ein individualistisches und drittmittelunabhängiges Pendant gegenüber. Der Erkenntnisprozess findet in vielen Fächern immer noch ganz unmittelbar in der forschenden Person statt. Sie gewinnt Erkenntnisse durch logisches Schließen – und braucht zur Finanzierung seiner Arbeit weitaus weniger finanzielle Unterstützung von außen. Weshalb sie auch auf die Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung weniger angewiesen ist. Die Mathematikerin oder der Philosoph stellen Prototypen von individualistisch und drittmittelunabhängig Forschenden dar.
Die Aufgabe des Präsidiums:
die Erwartungen in Einklang bringen
Die jeweiligen Produktionssysteme ziehen also unterschiedliche Erwartungen der Disziplinen an die Hochschulgovernance nach sich. Arbeitsteilige und drittmittelabhängige Produktionssysteme brauchen einen starken Präsidenten oder eine starke Präsidentin, um ihre Interessen im Wettbewerb um Ressourcen und Drittmittel durchzusetzen. Die Hochschulleitung stellt die Infrastruktur zur Einwerbung von Forschungsmitteln und zur Qualitätssicherung bereit und bürgt gegenüber den Drittmittelgebern für den bestimmungsgemäßen Mitteleinsatz. Individualistisch und drittmittelunabhängig Forschende brauchen dagegen lediglich eine effiziente Verwaltung, die den Zugriff auf das Büro, die Heizung, den Strom sowie Internet und Bücher sicherstellt. Und sie sehen in einer starken Hochschulleitung tendenziell eine unnötige Einschränkung ihrer wissenschaftlichen Freiheit.
Die Erwartungen der beiden Produktionssysteme an die "richtige" Governance – stehen einander gegenüber. Diese beiden Erwartungen in Einklang zu bringen, ist eine wesentliche Herausforderung für Hochschulleitungen.
Das Bayerische Hochschulgesetz schreibt in Artikel 21 die Rolle der Hochschulleitung vor: "Der Präsident oder die Präsidentin gibt Initiativen zur Entwicklung der Hochschule und entwirft die Grundsätze der hochschulpolitischen Zielsetzungen". Die Ziele – und auch hier macht das Bayerische Hochschulgesetz klare Vorgaben – stimmen die Mitglieder der Hochschule gemeinsam ab und schreiben sie gemeinsam in einem Hochschulentwicklungsplan fest. In der Folge muss ein Präsidium die Hochschulbereiche so mit Ressourcen ausstatten, dass die gemeinsam festgelegten Ziele erreicht werden – nichts anderes bedeutet eine Allokation von Ressourcen.
Wissenschaftsfreiheit – und das wird an dieser Stelle deutlich – zieht also nicht automatisch die Gleichverteilung von Ressourcen nach sich. Vielmehr steuert die Hochschulleitung die Zielerreichung der Hochschule durch die unterschiedliche Ausstattung von Projekten und Bereichen. Dabei orientiert sie sich an den unterschiedlichen Produktionssystemen sowie der Leistungsfähigkeit der einzelnen Fachbereiche und Kollegen. Ein Präsident moderiert hier zielstrebig am Auftrag der Hochschule entlang und setzt sich damit fast zwangsläufig immer wieder dem Ärger über die ungleiche Verteilung von Ressourcen aus.
Leistungskriterien wie Veröffentlichungen, Forschungspreise, Drittmittelerfolge, Board-Mitgliedschaften und dergleichen sind die mögliche Maßstäbe, auf die sich alle Mitglieder der Hochschule verständigen müssen. Nur dann kann ein Präsidium wissenschaftliche Leistungsfähigkeit messen und bewerten und daraus abgeleitet, die Ressourcenallokation optimieren. Deshalb sind alle Mitglieder der Hochschule aufgefordert, Kriterien für Leistung in den unterschiedlichen Fachbereichen zu finden und zu messen. Und dabei gilt es die Stärken der eigenen Hochschule zu erkennen und auszubauen, aber auch Schwächen zu identifizieren und Verbesserungen zu moderieren. So wird das System insgesamt leistungsfähiger gemacht.
Die eigentliche Herausforderung
liegt außerhalb der Hochschule
Gehen wir zurück zur Ausgangsfrage: Warum wird um die "richtige Governance" an Hochschulen so scharf gestritten? In diesem hochschulinternen Streit übersehen die Akteure oft, dass die eigentliche Herausforderung außerhalb der Hochschule liegt. Die Allokation von Ressourcen geschieht nur zu einem geringen Teil innerhalb der Hochschule. Der wesentliche Wettbewerb findet außerhalb – also zwischen den Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene statt. Das kann hier nicht deutlich genug betont werden.
Die frühere horizontale Hochschulanordnung verschiebt sich hin zu einer vertikalen Ausrichtung. Die Hochschulen werden durch Rangplätze und die Exzellenzinitiative für Studierende, Wissenschaftler, Drittmittelgeber und Öffentlichkeit besser unterscheidbar. Transparente und qualitätsgesicherte Hochschulsysteme erleichtern eine Leistungsmessung und –bewertung und führen zu einer überbetonten Allokation von Ressourcen auf die leistungsstärkeren, sprich exzellenten Hochschulen.
Die Hochschulleitung muss deshalb über die Strategie der Hochschule entscheiden, die Ressourcenallokation anhand qualitätsgesicherter, transparenter und fachspezifischer Kriterien vornehmen, Rechenschaft der Forschenden einfordern und ein forschungs- und drittmittelfreundliches Umfeld schaffen. Um das auf einer fairen und transparenten Basis tun zu können, muss das Präsidium ein zentralisiertes System der Qualitätssicherung und entsprechende Transparenz für alle Beteiligten schaffen. Nur dann kann die Hochschule auf Augenhöhe mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Drittmittelgeber und Ministerium verhandeln und Mittel einwerben. Von diesem professionellen Hochschulmanagement profitieren beide Produktionssysteme.
Damit die Hochschulen von inneren Gegensätzen nicht zerrissen werden, brauchen wir eine Kultur der Anerkennung der unterschiedlichen Produktionssysteme und dem jeweils zielgerichteten System der Resourcenallokation. Ich wünsche mir die Hochschule als Universitas, also als eine Gemeinschaft von Lehrenden und Studierenden bzw. der Wissenschaften insgesamt, die über das Ethos der Forschung an sich und die Anerkennung des jeweils anderen Produktionssystems miteinander verbunden sind. Nur eine starke Hochschulleitung ist in der Lage, diesen Prozess zu moderieren und mehr Ressourcen an die eigene Hochschule zu holen und die Reputation der Hochschule durch gezielte Maßnahmen zu steigern
Eine bessere
Zukunft erschaffen
Die Chancen der Forschenden, diese Vision mit Leben zu füllen, stehen gut: Die gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sind so gewaltig, dass jeder kluge Kopf und jede konstruktiv-kritische oder visionäre Idee zur Zukunftsgestaltung beitragen kann. Die Digitalisierung eröffnet insbesondere den Geisteswissenschaften neue Möglichkeiten. Sie ist ja nicht nur ein technologisches oder ökonomisches Thema, sondern übernimmt wichtige Interaktionsfunktionen des täglichen Lebens: In der Digitalisierung kommt der Sprache und ihrem kontextuellen Einsatz eine neue und zentrale Bedeutung zu.
Die unmittelbaren Folgen der Digitalisierung zeigen sich an der Umgestaltung politischer Systeme. Wir werden den gesellschaftlichen Wandel, der durch die Digitalisierung auf uns zukommt, vor allem mit Hilfe der darauf spezialisierten Geistes- und Sozialwissenschaften in Worte fassen können, und wir werden für die Änderungen der Regelungssysteme auf die Rechtswissenschaften zurückgreifen müssen. Und wenn wahrhaft innovative Forschung nur interdisziplinär möglich ist, müssen alle Produktionssysteme anerkannt werden und eine Chance haben.
Diese Chance zu nutzen, sind wir nicht nur unseren Studierenden und Forschungspartnerinnen und -partnern, sondern unserer ganzen Gesellschaft schuldig. Alle Produktionssysteme in der Wissenschaft dienen einem Ziel: Exzellente wissenschaftliche Ergebnisse zu erzielen und damit unserer Gesellschaft und der Menschheit als Ganzes eine bessere Zukunft zu erschaffen.
Kommentar schreiben
Liberaler (Dienstag, 24 März 2020 15:45)
"Damit die Hochschulen von inneren Gegensätzen nicht zerrissen werden, brauchen wir eine Kultur der Anerkennung der unterschiedlichen Produktionssysteme und dem jeweils zielgerichteten System der Resourcenallokation."
Klingt gut, hat aber mit der Realität nichts zu tun: Seit Jahrzehnten zwingen Politik und Hochschulleitungen (sowie die HRK als Lobbyorganisation der Hochschulleitungen) deutschen Geistes- und Sozialwissenschaftlern untaugliche Strukturen auf, nämlich Verbundforschung wie sie allenfalls in den Naturwissenschaften sinnvoll ist (aber auch dort geht Deutschland international betrachtet einen Sonderweg). Die "Exzellenzinitiative" hat alles nur noch schlimmer gemacht.
Das wird auch so bleiben, weil die Anreize natürlich so liegen, dass Hochschulleitungen mitnichten neutral sind, sondern die Art von "Wissensproduktion" (was für ein Unwort) favorisieren, die Ihnen am meisten Macht verschafft. Als Ökonomin hätte Frau Jungwirth das eigentlich sehen müssen. Aber schon der Duktus ihres Beitrages (Exzellenz, Exzellenz) verrät, dass sie hier als Lobbyistin schreibt. Schade.
Josef König (Dienstag, 24 März 2020 17:56)
Sorry, aber das ist ein typischer Beitrage einer Wirtschaftswissenschaftlerin, die Hochschulen und Unis mit wirtschaftlichen Produktionssystemen von Unternehmungen vergleicht. Daran ist schon in den 90ern Detlev Müller-Böling und seine "Entfesselte Universität" an die Wand geprallt.
Forschung ist in manchen Fächern sehr kostspielig, in anderen weniger kostspielig. Geld brauchen alle Fächer. Auch ein Philosoph brauch Bücher, ein Mathematiker häufig Hochleistungscomputer. Dennoch ist "Forschung" nur bedingt "planbar". Denn ihr Sinn ist eine prinzipielle Offenheit für Neues. Wie viel Forschung schlicht daneben geht - und somit die tatsächliche Zahl der gelungenen oder nicht gelungenen Allokation ermittelbar ist, bleibt deshalb außer Acht - und Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen bringt es keine Ehre, Forschungen anderer zu replizieren.
Simon Clausing (Mittwoch, 25 März 2020 15:25)
Es ist immer wieder schade, wenn Missstände im Hochschulsystem nur am Rande als Problem angesprochen werden, und ansonsten als gesetzt hingenommen werden. Sowohl die grobe Unterfinanzierung der Hochschulen und damit der Zwang zu Drittmittelbeschaffung als auch die daraus bedingte Notwendigkeit, überhaupt um Ressourcen konkurrieren zu müssen, ist ein viel massiveres Problem, als den exakten Entscheidungsprozess nachvollziehen zu können, wie selbige Ressourcen denn nun genau verteilt werden.
Es wird angesprochen, dass ein Mathematiker und eine Biologin ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben, was Mittelverteilung individuell oder im Team angeht, was völlig korrekt ist. Gerade ein Biologe benötigt etwa auch weitaus mehr Sachmittel als sogar eine Chemikerin. Jedoch wird dabei völlig außer Acht gelassen, dass all diese Forscher als Individuen eine große Geldmenge benötigen, die oft (außer vielleicht in Biologie und Medizin) den überwiegenden Löwenanteil des Budgets ausmacht: ihr Gehalt.
Da mittlerweile fast alle Stellen im wissenschaftlichen Mittelbau befristet vergeben werden, muss jeder Forscher nicht nur darauf achten, dass die für die Forschung selbst benötigten Mittel gerecht verteilt sind (worüber es in diesen Beitrag vor allem geht), sondern auch dass die Finanzierung für die eigene Stelle gesichert ist. Wenn dies der Professor/Arbeitsgruppenleiter durch ausreichende Zuteilung von Mitteln durch die Hochschulleitung leisten kann, ist das schön. Sehr oft müssen jedoch Drittmittelanträge in großer Zahl geschrieben werden, um überhaupt die Weiterbeschäftigung sichern zu können, die Qualität der Forschung, die Transparenz von internen Entscheidungsprozessen und so weiter hat damit nur sehr wenig zu tun.
Diese prekären Beschäftigungsverhältnisse, in denen unter großem Druck konstant mit einigem Aufwand bewiesen werden muss, dass die eigene Forschung es noch wert ist, weiterfinanziert zu werden, müssen endlich verbessert werden. Es kann nicht sein, dass ein signifikanter Anteil an Arbeitszeit von nahezu jedem Wissenschaftler dafür verschwendet wird, um einige wenige Geldtöpfe zu konkurrieren. Wäre dieses Problem durch eine Politikänderung gerade auch der HochschulrektorInnen zumindest etwas eingedämmt, würden sich auch viel weniger Konflikte bei der internen Mittelverteilung ergeben, da Menschen nicht mehr sowohl um die Anerkennung ihrer Forschung als auch um ihre eigene persönliche Zukunft kämpfen müssten.
Jan-Martin Wiarda (Sonntag, 29 März 2020 10:47)
@PNP: Vielen Dank für Ihren Kommentar. Um ihn freizuschalten, benötige ich aber in diesem Fall Ihren Klarnamen. Sie können sich auch gern per eMail bei mir melden.
Beste Grüße Ihr Jan-Martin Wiarda