Ganztag: Eine Grundschule in Berlin zeigt, wie es funktioniert
Angebote für alle Kinder nach Unterrichtsende versprechen mehr Chancengleichheit. Doch es gibt diverse Modelle für den Ganztag. Wie sich eine Grundschule in Neukölln wandelt, was das mit der Schulleitung zu tun hat – und was Bildungsforscher sagen.
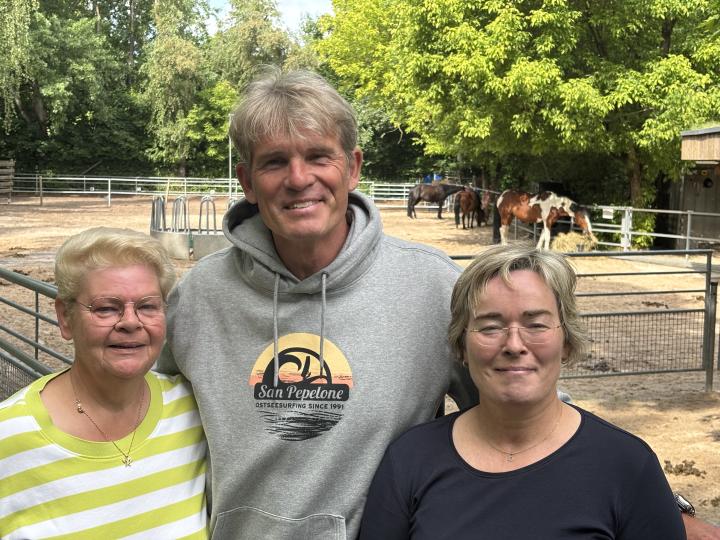
Pädagogisches Trio: Sabine Klemm, Koordinierende Erzieherin, Frank Durek, Konrektor, und Rektorin Heike Hertha (von links). Foto: Jan-Martin Wiarda.
Wenn Sabine Klemm über die Grundschule am Sandsteinweg vor zehn Jahren spricht, dann klingt das nach einer anderen Welt. "Wir Erzieher waren degradiert zum Shuttledienst. Nach der Schule holten wir die Kinder ab, brachten sie rüber zum Hort, und das war eigentlich der einzige Kontakt zur Schule." Damals habe sie daran gedacht, früher in Rente zu gehen.
2025 sitzt Klemm, inzwischen 68, im Büro der Schulleitung, neben ihr Rektorin Heike Hertha und Konrektor Frank Durek, und erzählt davon, dass sie zum zweiten Mal erfolgreich ihren Renteneintritt verschoben hat. Klemm ist Koordinierende Erzieherin im Ganztagsbereich, mit Hertha und Durek versteht sie sich als "Tridem", gemeinsam haben sie ihre "SamS" zu einem Beispiel dafür gemacht, wie Ganztagsschule in Deutschland funktionieren kann – und woran sie anderswo oft scheitert.
Im Berliner Ortsteil Buckow, da, wo der Neuköllner Süden in kleinen Einfamilienhäusern und Wohnanlagen mit viel Grün ausläuft: Hier befinden sich der Sandsteinweg und die größte Grundschule im Bezirk, eine ausgedehnte Ansammlung von Flach- und Modulbauten aus den 50ern bis 80ern mit viel Beton auf dem Schulhof. Dazwischen Ställe und Koppel für die fünf Pferde, angeschafft durch den überaus aktiven Schulförderverein, ein Gehege für das schulische Hängebauchschwein und jede Menge Spielgerüste, deren Finanzierung Generationen von Schülern im jährlichen Spendenlauf erkämpft haben. Vor ein paar Jahrzehnten wurde das Schulgelände gar durch einen ausrangierten Fußballplatz samt Vereinsheim erweitert. So baufällig es ist, gerade haben die Eltern es innen neu gemalert, damit es weiter als Ersatz dienen kann für den seit Jahren versprochenen, aber immer noch nicht realisierten Mensaneubau.
Eine Schule, die sich nicht durch Sanierungsstau bestimmen lassen will, die aber auch, sagt Rektorin Hertha, günstigere soziale Voraussetzungen hat als anderswo: 46 Prozent der Kinder sprechen an der "SamS" zu Hause eine andere Sprache als Deutsch, an vielen Schulen in Neukölln sind es bis zu 100 Prozent. "Bei uns stimmt das Verhältnis noch", sagt Hertha. "Es ist nicht so, dass sich eigene Communitys abschotten – es ist wirklich eine Schulgemeinschaft."
Es gab eine Zeit, da waren die bildungspolitischen Erwartungen an die Ganztagsschule bundesweit groß. Anfang des Jahrtausends war das, gerade hatten die Ergebnisse der ersten PISA-Studie die Bundesrepublik erschüttert: Die deutschen Neuntklässler konnten schlechter lesen und schreiben als der internationale Durchschnitt, und noch dazu hing ihr Bildungserfolg stark von ihrer sozialen Herkunft ab. Die Bundesländer reagierten mit einer Vielzahl an Schulreformen – und die damalige Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn mit einem riesigen Investitionsprogramm.
Vier Milliarden Euro flossen in den Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen, sie seien "ein Impuls für neue Gestaltungsmöglichkeiten im Schulsystem", sagte die SPD-Politikerin, der Weg hin zu besseren Bildungschancen "für die Kinder und Jugendlichen in unserem Land".
Als Goldstandard galt der sogenannte gebundene Ganztag: der Umbau der bis dahin in Deutschland gängigen Halbtagsschule in ein pädagogisch – und für alle Schüler verpflichtendes – abgestimmtes Unterrichts- und Betreuungsangebot über den ganzen Tag. Studien zeigten, dass davon besonders Kinder profitieren, die keine oder wenig Unterstützung von ihren Eltern erhalten. Voraussetzung: Die Qualität der pädagogischen Angebote stimmt.
Gut zwei Jahrzehnte später hat sich die Zahl der Ganztagsschulen in Deutschland von gut 3.000 auf über 19.000 versechsfacht, rund die Hälfte der Schüler besucht eine Schule mit Ganztagsangeboten. In Berlin arbeiten laut offizieller Statistik inzwischen gar alle Grund-, Förder- und weiterführende Schulen im Ganztagsbetrieb, lediglich an den Gymnasien liegt der Anteil mit einem Drittel deutlich niedriger. Eine beeindruckende Entwicklung. Einerseits.
Andererseits sind rund 80 Prozent der Ganztagsschulen in Deutschland und Berlin laut Definition der Kultusministerkonferenz (KMK) sogenannte offene Modelle: freiwillig, ohne Verpflichtung und oft ohne klaren pädagogischen Zusammenhang zwischen Vor- und Nachmittag. Der Bildungsforscher Olaf Köller vom IPN Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik spricht einem "Flickenteppich, einem Angebotsbetrieb ohne klare Programmstruktur – von Kompensation oder gezielter Förderung ist das weit entfernt."
Missstände stießen Reformen an
Blieb von den hochfliegenden Ganztags-Bildungsambitionen von einst am Ende nur das Ziel, möglichst viele Kinder zu betreuen, während die Eltern arbeiten gehen?
Wobei selbst dieses Ziel nicht gesichert scheint: Einen bundesweiten Rechtsanspruch für Grundschüler auf Ganztag, lediglich auf "Ganztagsbetreuung" wohlgemerkt, will die Politik zwar nächstes Jahr, 25 Jahre nach dem PISA-Schock einführen, aber nur stufenweise, angefangen mit Klasse 1 ab August 2026 und aufwachsend bis Klasse vier 2009. Und obwohl der Start bereits um ein Jahr verschoben wurde, musste die Bundesregierung gerade erst die Abruffrist für die Fördermittel im jüngsten Ausbauprogramm um zwei Jahre verlängern – weil sie von den Schulträgern nicht schnell genug abgerufen wurde.
Viele Kommunen hatten sich gar im Wahlkampf für eine weitere Verschiebung des gesetzlichen Rechtsanspruchs eingesetzt. An dem werde aber nicht gewackelt, versichert Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU), doch gelinge Ganztagsbetreuung "nur mit Verlässlichkeit und realistischem Blick auf die Herausforderungen vor Ort."
Mit dem realistischen Blick fing es auch am Sandsteinweg an. Ende 2015 war das, Hertha und Durek hatten gerade die Schulleitung übernommen, doch statt Aufbruch gab es einen Brandbrief der Eltern. Der Hort platzte aus allen Nähten: Ausgelegt auf 160 Personen, füllten ihn zu Spitzenzeiten 260 Kinder, es war eng, die Stimmung aggressiv, durch die Ganztagsschule ging ein Riss: pädagogisch – und räumlich. Jeden Tag mussten die ersten drei Klassenstufen vom Sandsteinweg 500 Meter rüber zum Muschelkalkweg laufen.
Die Missstände gaben den Anlass für weitreichende Reformen: Der Ganztagsbetrieb für die Klasse 1 bis 3 wurde ins Schulgebäude integriert, und jede Klasse bekam einen festen Klassenerzieher, der regelmäßig im Schulalltag präsent war. Ein neues Miteinander entstand, sagt Klemm. "Wir haben das Ding in Eigenregie gedreht." Fortan wurden Hausaufgabenzeiten gemeinsam gestaltet, Klassenfahrten, Vertretungen, Ausflüge und Unterrichtsthemen zwischen Schule und Hort abgestimmt. Es etablierte sich die wöchentliche Teamstunde zwischen Lehrern und Erziehern, die über das normale Stundenbudget hinausging – für die Lehrer eine zusätzliche, freiwillige Stunde, die aber von vielen rasch als Gewinn empfunden wurde.
Zum Glück hatte man etwas, auf dem sich aufbauen ließ. Seit 2012 bereits gibt es am Sandsteinweg den jahrgangsübergreifenden Projektunterricht für die Klassen 2 bis 5: Wöchentlich werden zwei Stunden aus dem Regelunterricht herausgelöst, in denen die Kinder nach Interessen Projektgruppen wählen können. Die Themen reichen von "PowerPoint" bis "Häkeln und Stricken", von "Saurier" bis "Zirkus". Lehrerinnen, Erzieherinnen und sogar Ehemalige gestalten diese Angebote gemeinsam – oft interdisziplinär und rollenunabhängig.
Ein breites Angebot für die Schüler
Und dann sind da die 36 Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag, die Breite ist auch hier erstaunlich: vom Reiten auf den Schulpferden über die MINT-AG und den Chor bin hin zu Französisch und dem Basketballtraining, verantwortet von ALBA Berlin. Wo möglich, knüpfen die AGs inhaltlich an den Schulvormittag an: Die MINT-AG etwa vertieft für Fünft- und Sechstklässler Themen aus den Naturwissenschaften Mathe und Informatik, kreative Kurse fördern Feinmotorik und soziale Verantwortung.
Die Grundschule am Sandsteinweg: ein Paradebeispiel für den gebundenen Ganztag? Mitnichten: Tatsächlich sind sämtliche Nachmittagsangebote auch hier offen, das heißt freiwillig. "Oftmals denke ich, wir sind ein gebundener Ganztag. Nur ohne den Zwang", sagt Heike Hertha. Wobei das nicht gleichbedeutend mit Beliebigkeit sei, sagt Frank Durek: "Es gilt: Wer sich für eine AG anmeldet, soll auch kommen. Sonst bekommt jemand anderes den Platz."
Mit dem Ergebnis, dass fast alle Kinder, insbesondere in den Klassen 1 bis 3, regelmäßig am Nachmittagsprogramm teilnähmen – nicht, weil sie müssten, sondern weil sie und ihre Eltern es wollten. Und vielleicht auch, weil sie spüren, dass die Lehrer und Erzieher ihre Schule als gemeinsames Projekt begreifen. So wie Sabine Klemm, die auch zwei Jahre nach Erreichen des offiziellen Rentenalters weiter jeden Tag den weiten Weg aus Marzahn hierher kommt.

Stefan Kielblock von der Universität Oldenburg erforscht seit vielen Jahren den Ganztag. Er spricht von einem strukturellen Dilemma: Zwar zeigten Daten, dass die freiwillige Teilnahme am Ganztag oft wirksamer sei. Doch gerade jene Kinder, die besonders von Ganztagsangeboten profitieren könnten, "sind nicht unbedingt diejenigen, die freiwillig kommen." Daher das Plädoyer vieler Forscher zum gebundenen Ganztag.
Doch Kielblock sagt: "Die Qualitätsfrage und die Frage der Organisationsform würde ich strikt trennen." Entscheidend sei, dass die Abstimmung zwischen Schule und Ganztagsbereich funktioniere, dann sei der Ganztag auch in der freiwilligen Form attraktiv genug.
Ganztag müsse mehr erforscht werden
Oft scheitere diese Abstimmung nicht am mangelnden Willen, sondern an Problemen, die Einzelschulen nicht lösen könnten: weil der Unterricht in der inhaltlichen Verantwortung des Schulministeriums liege, der Nachmittag aber in der Verantwortung von Sozialministerium und kommunalem Schulträger. Womit es am Ende natürlich doch wieder eine Frage der Organisationsform ist: "Wenn die Politik den Ganztag pädagogisch zum Erfolg machen will", sagt Kielblock, "braucht es klare Zuständigkeiten, institutionelle Kooperation – und politische Priorisierung" – auch der Bildungsforschung zum Ganztag, die mangels Finanzierung fast nicht mehr stattfinde.
Olaf Köller sagt dagegen: So, wie der Ganztag im Augenblick in Deutschland größtenteils organisiert sei, das zeige die Begleitforschung längst eindeutig, "gibt es keinerlei signifikante Kompetenzvorteile für Ganztagskinder gegenüber Schülerinnen und Schülern von Halbtagsschulen".
Warum aber hat sich der gebundene Ganztag dann nicht durchsetzen können? "Der gebundene Ganztag ist teurer, weil er mehr Personal und Kooperationszeiten braucht", sagt Bettina Arnoldt vom Deutschen Jugendinstitut (DJI). "Und nicht alle Lehrkräfte wollen sich so stark einbinden lassen." Zudem gebe es verbreitete Elternvorbehalte: "Viele Eltern wünschen sich flexible Lösungen. Ganztägige Angebote an nur zwei oder drei Tagen – das ist für viele attraktiver."
Köller plädiert dennoch für eine Neujustierung des Systems – mit mehr Verbindlichkeit, Professionalität und sozialer Zielgerichtetheit. "Es braucht mindestens einen teilgebundenen Ganztag, um überhaupt pädagogisch wirksam werden zu können." Dazu gehöre auch eine kluge Differenzierung: "Im Grundschulbereich würde man eine größere Akzeptanz für verpflichtende Zeitfenster haben – etwa bis 15 Uhr." Klar sei aber auch: Es brauche realistische Modelle, die Elternwünsche und Personalressourcen berücksichtigen. "Hauptsache, die Kinder werden in der Zeit, in der sie im Ganztag sind, wirklich gezielt unterstützt."
Das Startchancen-Programm von Bund und Ländern, das mit Milliarden sozial benachteiligte Schüler und Schulen fördert, biete hier vielleicht 25 Jahre nach Pisa 2000 ein neues Gelegenheitsfenster, hofft Köller – und teilt diese Hoffnung mit DJI-Forscherin Arnoldt: "Dort, wo Kinder besondere Unterstützung brauchen, könnte es einen neuen Impuls für gebundenen Ganztag geben. Aber bitte nicht abhängig machen von der Schulform – sonst entsteht ein Stigma."
Berlins Bildungsverwaltung finanziert eigens eine "Serviceagentur Ganztag Berlin" (SAG), hinter der die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung steht. Das Ziel: Die Qualitätsentwicklung im Ganztag aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen.
Wenn man indes das Leitungstrio am Sandsteinweg fragt, was ihnen geholfen hat, lautet die Antwort: Zeit. Und die Teilnahme an "Ganztagschule gemeinsam gestalten", für das sich die Wübben-Stiftung 2021 in Berlin mit der Bildungsverwaltung zusammengetan hat. Fortbildung, Schulentwicklungsberatung und Coaching für neun Berliner Ganztagsschulen in drei Bezirken. Mit am Bord auch hier: die SAG. Doch während viele Schulleitungen von der Verwaltung aktiv angesprochen wurden, bewarben sich Hertha, Durek und Klemm auf dem Höhepunkt der Corona-Zeit mit ihrer Schule selbst. Und bekamen so erstmals Beratung und Gelegenheit zum Reflektieren ihrer Arbeit außerhalb des hektischen Schulalltags. "Plötzlich hatten wir die Möglichkeit, zurückzutreten, uns zu fragen: Was machen wir eigentlich? Was brauchen wir noch?", sagt Heike Hertha. "Dieses Fragen hört nie auf, weil sich die Bedürfnisse der Kinder ständig weiterentwickeln."
Dieser Artikel erschien in kürzerer Fassung zuerst im Tagesspiegel.
Kommentare
#1 - Naturerfahrungsräume (NER)
So etwas bräuchten möglichst viele Grundschulen für Vormittagsunterricht und Betreuung, um den Kindern Draußenspiel und Draußenlernen zu ermöglichen: Naturerfahrungsräume sowie Abenteuerspielplätze/Kinder- und Jugendfarmen, ideale Spiel- und Lernorte für Kinder und Jugendliche in freier Natur
Ein Naturerfahrungsraum (NER) besteht idealerweise aus ca.10.000qm möglichst noch natürlichem Gelände mit Wiese und Bäumen, welches Kindern das Spiel in freier Natur unter Verwendung natürlicher Materialien wie Stöcke, Blätter, Steine, Gras, Sand, Erde usw. ermöglicht. Schulklassen oder Kita-Gruppen können es mit ihren Lehrer*innen bzw. Erzieher*innen regelmäßig besuchen, auch um dabei den Lauf der Jahreszeiten und ökologische Kreisläufe nachzuvollziehen. Es ist eine in Schul-, Kita- und Wohnnähe gelegene Naturoase, bei der Kinder Vorrang haben und die sie auch in ihrer Freizeit mit Freunden*innen sowie ihrer Familie bespielen können. Nähere Informationen unter www.naturerfahrungsraum.de sowie bei Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Naturerfahrungsraum. Sie benötigen keine Extra-Stellen für pädagogisches Personal, es reichen Kümmerer*innen für das Gelände. Dieses Konzept ist vielfach erfolgreich erprobt, s.a. „Was sind Naturerfahrungsräume?“ unter www.stiftung-naturschutz.de – Umweltbildung – Naturerfahrungsräume sowie der „Leitfaden Naturerfahrungsräume in Großstädten“ auf www.bfn.de. Mittlerweile gibt es auch einen Zuschuss des Bundes von 80% - 90% für die Einrichtung und Pflege für über 3 Jahre solcher NER. Abzurufen über die Kreditanstalt für Wiederaufbau www.kfw.de – Öffentliche Einrichtungen – Städte und Gemeinden gestalten – natürlicher Klimaschutz in Kommunen – Zuschuss Nr. 444, dort: Was fördern wir? – C2 und C6 anklicken. Es reicht auch kfw.de und „Naturerfahrungsräume“ zu googeln. Städte und Gemeinden können den Zuschuss beantragen, man muss es aber bei Verwaltung und Politik anstoßen.
Sprechen Sie mich für weitere Artikel oder Nachfragen gerne an: Wilfried Juch, Grundschullehrer in Offenbach auch im Ganztag arbeitend, praktiziere einen solchen NER mit den Schülern seit über 15 Jahren und sie stehen drauf.
w.juch@gmx.de, +49 176 75037483 , www.ajahessen.de





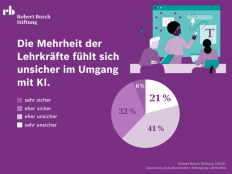


Neuen Kommentar hinzufügen