Das fragile Ethos der Unabhängigkeit
Wie politische Eingriffe und systeminterne Verzerrungen die Unabhängigkeit der Forschung bedrohen – und welche Bedingungen Forschung heute wirklich frei machen. Ein Gastbeitrag von Peter Dabrock.

Peter Dabrock ist Professor für Systematische Theologie mit dem Schwerpunkt Ethik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Von 2012 bis 2020 war er Mitglied des Deutschen Ethikrates, von 2016 bis 2020 dessen Vorsitzender. Seit 2017 ist er Mitglied, seit 2022 im Präsidium der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech). Foto: FAU/G. Iannicelli.
WER ÜBER DEN GROßEN TEICH BLICKT, erkennt mit wachsendem Entsetzen, wie in kürzester Zeit die Freiheit der Wissenschaft unter Beschuss gerät. Die besten Universitäten werden mit Milliardenklagen überzogen, Parawissenschaften erhalten Rückendeckung, Forschungsergebnisse sollen nicht mehr in anerkannten Fachzeitschriften erscheinen, sondern in regierungsnahen Publikationsorganen. Politische Steuerung kolonisiert wissenschaftliche Fachlogiken. Zugleich wird die öffentliche Kommunikation, in die auch Forschung eingebettet ist, durch destruktive Algorithmen ausgehöhlt. Emotionen verdrängen Differenzierungen, Aufmerksamkeitslogiken ersetzen Wahrheitsorientierung. Plattformen wie X und Meta lassen zu oder befördern, dass nicht nur Fake News, sondern auch Bullshit die Diskurse fluten. Unter Bullshit versteht der amerikanische Philosoph Harry Frankfurt sinnfreies Gerede, das sich – anders als Fake News – der Unterscheidung zwischen "wahr" und "falsch" entzieht. Während Lüge und Fake News noch indirekt den Wahrheitsanspruch anerkennen, indem sie ihn aushebeln wollen, will Bullshit das Vertrauen in jede Aussage unterminieren. Wenn niemand mehr darauf vertrauen kann, dass eine Rede auf Wahrheit zielt, wird auch wissenschaftlicher Rede misstraut. Ohne dieses Vertrauen droht Wissen zur Meinung, Wissenschaft zu einer Meinungsmacht – mehr aber auch nicht – zu verflachen.
Was aber folgt daraus für die Wissenschaft selbst? Was bedeutet diese Erosion von Wahrheitsvertrauen für die Frage, ob und wie Wissenschaft in demokratischen Gesellschaften unabhängig bleiben kann? Dieser Beitrag soll zeigen, dass deren Unabhängigkeit kein Zustand, sondern ein kultiviertes Ethos ist – und dass sie nur dann Bestand hat, wenn Institutionen, Finanzierungsformen und wissenschaftliche Kulturen ihr aktiv Raum geben.
Erstens: Wissenschaft braucht methodisch geleitetes Wahrheitspathos
Gesellschaft lebt davon, dass man am besten mit Gründen alles hinterfragen kann – auch sich selbst. Fortschritt entsteht, wo Kritik am Status quo institutionell und kulturell geschützt ist. Nicht dass das Neue per se das Bessere wäre; aber nichts darf unhinterfragt bleiben. Wissenschaft ist nicht das gesellschaftliche System, das in seiner kritischen Funktion immer recht hat gegenüber Politik, Medien, Kultur, Religion oder Recht. Der Satz "Follow the Science!" (zu Recht oder Unrecht Teilen der Klimabewegung zugeschrieben) ist so unwissenschaftlich wie sonst nur was. In den Wissenschaften – und hier ist mir der Plural schon konstitutiv wichtig – gelten Theorien und empirische Ergebnisse nur so lange als gesichert, bis sie falsifiziert worden sind. Wahrheit im Sinne alter metaphysischer – also zeitlos hinter den Dingen liegender – oder religiöser Gewissheiten gibt es in den modernen Wissenschaften wohl nicht mehr. Zu den hochspezialisierten Fragen der mathematischen Wissenschaftstheorie möchte ich mich nicht äußern, dafür fehlt mir die nötige Kompetenz. Doch daraus folgt nicht, dass Wahrheit in den Wissenschaften bedeutungslos wäre. Wissenschaften sind methodisch geleitete Verfahren, Standards und Institutionen, um den Erkenntnisstand voranzubringen und somit begründet Gegebenes und für wahr Erachtetes zu hinterfragen.
In den Naturwissenschaften geschieht dies durch einen komplexen Prozess, in dem Hypothesen durch Datensammlung und -auswertung gebildet, reproduziert und gegebenenfalls falsifiziert werden. In den Geistes-, Kultur-, Sozial- und Normwissenschaften (englisch: Humanities) greifen zwar empirische Methoden und Hypothesenbildung immer stärker um sich. Doch die wissenschaftliche Expertise entsteht hier – je nach Grad der Deutungsoffenheit und Normativität der jeweiligen Disziplin – vor allem durch interne und externe Kohärenzbildung sowie durch Angemessenheits- und Anwendungsprüfungen. Dabei darf Wissenschaftlichkeit in den Humanities nicht daran gemessen werden, ob sie denselben Standards folgt wie die Sciences. Solche Unterschiede und Streitfragen gehören zu den internen Aushandlungsprozessen des Wissenschaftssystems, auch wenn sie von äußeren Erwartungen beeinflusst werden. Nicht selten wird von den Humanities Exaktheit verlangt, die nicht ihr primäres Erkenntnisziel darstellt, und von den Sciences Freiheit von Hypothesen, die diese wiederum nicht leisten können. Werden solche Übererwartungen nicht erfüllt, erschallt aus Unkenntnis der wissenschaftstheoretischen Grundlagen schnell der Vorwurf mangelnder Genauigkeit.
Zweitens: Unabhängigkeit im Gefüge der Wissenschaften gewährleisten
Damit aber zur zweiten Frage: Wie kann Unabhängigkeit im Gefüge der Wissenschaften praktisch gewährleistet werden – jenseits der Unterschiede zwischen Natur- und Geisteswissenschaften? Wissenschaft ist ein besonderes, keineswegs ausschließliches Ordnungssystem, Wissen zu produzieren, altes zu hinterfragen und neues zu gewinnen – und sie ist auch kein monolithischer Block. Schon die Verständigung über einen Erkenntnisbereich schafft interne Friktionen – man denke nur an die unterschiedlichen Einschätzungen während der Coronapandemie. Oft war vom Streit zwischen Disziplinen die Rede, ohne dass eine der anderen die Wissenschaftlichkeit absprechen konnte. Entsprechend tauchte in der Öffentlichkeit der Verdacht auf, solche Differenzen seien Ausdruck mangelnder Unabhängigkeit – ein Missverständnis.
Nur wenn Wissenschaft möglichst frei und unabhängig ihrer genuinen Aufgabe, methodisch exakt und nachvollziehbar zur Vermehrung der wahrheitsgeleiteten Erkenntnis beizutragen, nachkommen kann, trägt sie in ihrer Ergebnisoffenheit zum gesellschaftlichen Fortschritt bei. Auch wenn für viele das Ideal zweckfreier Grundlagenforschung à la Max-Planck-Gesellschaft verkörpert ist, geht Wissenschaft darin nicht auf. "Zweckfrei" und "interessenfrei" ist Wissenschaft fast nie. Das gilt schon im Normalbetrieb, wo es kräftig menschelt: Konkurrenz um Anerkennung, Stellen, Drittmittel, Reputation. Hier wird deutlich: Unabhängigkeit ist weniger eine Strukturfrage als eine Haltung. Sie ist kein Zustand, sondern ein Ethos – die Bereitschaft, eigene Interessen zu reflektieren und transparent zu machen. Wissenschaftliche Kritik bewährt sich nicht durch Beharren auf Reinheit, sondern durch den Umgang mit unvermeidlicher Nicht-Unabhängigkeit.
In demokratischen Gesellschaften geht es weniger um das Ideal völliger Autonomie als um eine kluge Balance zwischen Effizienz, Effektivität und Unabhängigkeit. Es lässt sich kaum eindeutig nachweisen, welche Finanzierungsmodelle wissenschaftliche Unabhängigkeit fördern und welche im Gegenteil neue Abhängigkeiten erzeugen. Dennoch zeigt die Erfahrung, dass sich – sofern man die Drittmittellogik akzeptiert – einige verlässliche Standards festhalten lassen. Sie betreffen die Begrenzung direkter Einflussnahme, die Sicherung wechselseitiger Unabhängigkeit im System und die Transparenz der Förderverfahren.
Drittens: Warum es organisatorische Hygieneregeln braucht
Weil Auftragsforschung nicht per se verwerflich ist, müssen institutionelle Designs sicherstellen, dass kein manipulativer Einfluss auf Forschung ausgeübt wird: unabhängige Governance-Boards, Brückenfonds, Blind-Reviews, klare Compliance-Regeln. Gerade in gesellschaftlich sensiblen Bereichen wie Medizin, Klima- oder Energieforschung kann Bürger- oder Patient:innenbeteiligung das Vertrauen stärken – sofern wissenschaftliche Qualität gesichert bleibt.
Ein dritter, oft übersehener Aspekt betrifft die innere Kultur der Wissenschaft. Unabhängigkeit hängt nicht nur an Geldflüssen, sondern an alltäglichen Strukturen: Hierarchien, Machtgefälle, Abhängigkeiten. Deshalb braucht es organisatorische Hygieneregeln: Interessenkonflikt-Register, Whistleblower-Schutz, transparente Begutachtungen. Der Open-Science-Pfad sollte Regelfall sein – mit Ausnahmen, wo Datenschutz oder Sicherheitslagen es verlangen. Diversity-Monitoring kann helfen, strukturelle Verzerrungen sichtbar zu machen.
Viertens: die Finanzierungslogik selbst
Ein massives strukturelles Problem liegt in der Kurzfristigkeit der Projektförderung. Die üblichen drei Jahre reichen kaum aus, um nachhaltige Forschung zu ermöglichen. Erforderlich wären längere Laufzeiten, verbunden mit Zwischenbegutachtungen – ähnlich wie bei den ERC Advanced Grants oder den Wellcome Discovery Awards. Solche Modelle fördern Konzentration und Kontinuität, anstatt Forschende in immer neuen Antragsroutinen zu binden. Mehrstufige Verfahren mit anonymen Ideenskizzen, Teil-Lotterien bei Gleichrangigkeit und weniger bürokratische Formate könnten Unabhängigkeit und Qualität zugleich stärken.
Auch das Publikationswesen belohnt Neuartigkeit, nicht Nachprüfbarkeit. Replikationsstudien, Nullbefunde und offene Datenpraktiken würden Vertrauen stärken. Doch wer das tut, riskiert Karrierenachteile – ein Paradox, das das System selbst erzeugt. Zugleich schaffen Open-Science-Plattformen neue Abhängigkeiten von großen Verlagen und Infrastrukturen.
Der Elefant im Raum: das Verhältnis von Grund- zu Projektfinanzierung
So berechtigt all diese Reformvorschläge sind, bleibt der Elefant im Raum: das Verhältnis von Grund- zu Projektfinanzierung. Während einst die Grundausstattung wissenschaftliche Selbststeuerung garantierte, dominiert heute der Wettbewerb um Drittmittel. Nach dem DFG-Förderatlas 2024 stammen rund siebzig Prozent der Universitätsforschung aus Grundmitteln, dreißig Prozent aus befristeten Projekten – Tendenz steigend. Das erzeugt ein Dauerkarussell aus Anträgen, Begutachtungen und Verlängerungen. Wettbewerb mag politisch attraktiv erscheinen, praktisch aber frisst er Zeit, Energie und Kreativität – und verfestigt Abhängigkeiten, statt sie zu lösen.
Die meisten Forschenden ruhen sich nach einer gewonnenen Lebenszeitstelle nicht aus – im Gegenteil: Endlich von prekären Bedingungen befreit, sprühen sie vor Ideen. Was sie brauchen, ist Vertrauen, nicht Dauerrechtfertigung. Statt kurzatmiger Projektitis sollte die Politik langfristige Grundförderung stärken. Es wäre also Zeit, die Prioritäten neu zu justieren: weniger Wettbewerbsrhetorik, mehr institutionelles Vertrauen. Nur so entsteht die Ruhe, in der wirklich Neues wachsen kann. Der Kompass zeigt – bei aller nötigen Feinjustierung – sicher in die Richtung: mehr Grundfinanzierung, weniger Projektfinanzierung. Wenn schon Projekte, dann so, dass sie nachhaltig komponiert und orchestriert werden – etwa durch Forschergruppen oder Sonderforschungsbereiche. Exzellenzuniversitäten dagegen dienen oft als Schaufenster und stürzen jene, die ihren Titel verlieren, in tiefe Finanz- und Identitätskrisen.
Von hier aus lässt sich der Bogen zurück zum Anfang schlagen: Wo Vertrauen schwindet – im Diskurs wie im System –, verliert Wissenschaft ihre Freiheit. Nicht immer sind und sollten schnelle Ergebnisse erwartet werden. Geduld – in diesen Zeiten weder individuell noch gesellschaftlich geschätzt – wäre der beste Ansatz, um exzellente und unabhängige Forschung zu ermöglichen. Damit man Geduld sinnvoll und nicht verzweifelt übt, braucht es Vertrauen in wissenschaftliche Arbeit und Institutionen. Das Engagement der meisten Forschenden rechtfertigt es, ihnen dieses Vertrauen entgegenzubringen.
Unabhängige Wissenschaft ist kein Mythos, sondern ein verletzliches Gut – angewiesen auf demokratische Kultur, offene Institutionen und Menschen, die sich ihrem Ethos verpflichtet wissen. Sie bleibt eines der kostbarsten Versprechen moderner Gesellschaften: dass Erkenntnis nicht bloß als Machtmittel, sondern als geteilte Suche nach (mehr) Wahrheit verstanden wird – kritisch, transparent, verantwortungsvoll.



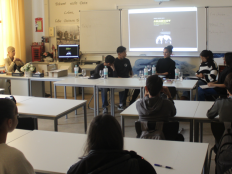




Neuen Kommentar hinzufügen