"Wir bauen in Deutschland zu langsam und zu teuer"
Schneller bauen, günstiger bauen – und warum sie Studierenden zum Gründen rät: Die SPD-Bundesbauministerin über den Bau-Turbo, den Gebäudetyp E, den sozialen Wohnungsbau, den Sanierungsstau an den Hochschulen und das Bund-Länder-Programm "Junges Wohnen".

Verena Hubertz, Jahrgang 1987, ist seit Dezember 2024 Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. 2021 wurde sie erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt und prompt stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion mit Zuständigkeit unter anderem für Bau-, Stadtentwicklungs- und Digitalpolitik. Foto: Charles Yunck.
Frau Hubertz, Alterspräsident Gregor Gysi hat in der konstituierenden Sitzung des Bundestags im Mai 2025 den Vorschlag gemacht, die Universität Trier in Karl-Marx-Universität umzubenennen. Das ist die Universität, an der Sie studiert haben – in dem Wahlkreis, den Sie vertreten. Ihr unmittelbarer Kommentar damals lautete: "Das wäre doch mal was." Meinten Sie das ernst?
Das fände ich wirklich toll. Die Studierenden dort haben schon einmal einen Pulli mit der Aufschrift "Karl-Marx-Universität Trier" entworfen – einen davon möchte ich Herrn Gysi noch schenken, er ist nur leider gerade vergriffen. Trier ist ja nicht nur die älteste Stadt Deutschlands mit reichem römischen Erbe, sondern auch die Geburtsstadt von Karl Marx. Ein bisschen Kreativität und der Mut, mal out of the box zu denken, würden der Stadt gut stehen.
Machen Sie sich mit solch einem Plädoyer viele Freunde in der Stadt?
Wahrscheinlich nicht. Trier ist stark katholisch geprägt und Karl Marx polarisiert, besonders in nicht-linken Kreisen. Der Vorschlag fand schon früher keine Mehrheit. Aber manchmal lohnt es sich, Ideen wieder ins Spiel zu bringen – auch wenn eine Namensänderung derzeit nicht absehbar ist.
In Trier haben Sie Ihren Bachelor gemacht, Ihren Master an der WHU in Vallendar. Welche Rolle spielte in Ihrem Studium das Studierendenwerk?
Eine sehr große. In Trier war das Studierendenwerk, wie an vielen Hochschulorten, Dreh- und Angelpunkt. Die Mensa war für mich als Studentin zentral – ohne sie hätte ich das Studium kaum organisatorisch geschafft: von zu Hause ausziehen, lernen, und trotzdem regelmäßig eine warme Mahlzeit bekommen. Die Mensa war zugleich Begegnungsort. Wir haben dort nicht nur gegessen, sondern auch gelernt.
Und das Essen?
Das war super. Zu meiner Zeit war das Hähnchenfilet am Mittwoch der Renner. Heute gibt’s in Trier sogar einen "Burger-Generator": Man stellt sich online seinen Burger zusammen, bezahlt und holt ihn ab. Die alten Vorurteile über Mensaessen stimmen einfach nicht. Und ich habe in vielen Mensen gegessen. Außerdem schafft das Studierendenwerk Wohnplätze. Ich selbst habe in einer WG gewohnt, viele Freunde aber im Wohnheim – dort haben wir etliche schöne Abende verbracht.
Ihr Vater war Schlosser, Ihre Mutter Gemeindereferentin in der katholischen Kirche.
Meine Mutter hat studiert, mein Vater nicht. Wer aus einem nicht-akademischen Elternhaus kommt, landet anfangs in einer völlig neuen Welt. Das Studierendenwerk bietet dabei Orientierung, Beratung und Begegnung – es ist Herz und Seele des studentischen Lebens. Wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, erinnere ich mich weniger an BWL-Folien oder "Porter‘s Five Forces", sondern an Menschen, Gespräche, gemeinsame Erlebnisse. Genau dafür schaffen die Studierendenwerke Räume. Und das ist entscheidend, damit junge Menschen sich nicht allein gelassen fühlen.
Die schwarz-rote Koalition will eine WG-Garantie für Auszubildende und Studierende einführen. Was bedeutet das konkret?
Wir wollen, dass junge Menschen ohne oder mit geringem Einkommen auf dem aktuell überlasteten Wohnungsmarkt nicht benachteiligt werden. Die WG-Garantie ist eine Idee der Jusos – Philipp Türmer hat sie in den Koalitionsvertrag gebracht. Es geht um mehr bezahlbaren Wohnraum und um bessere Beratung: Wo finde ich etwas? Welche Rechte habe ich? Viele zahlen Mieten, die gar nicht zulässig sind. Es ist ein Bündel von Maßnahmen, kein einzelnes Instrument – aber ein wichtiges Signal.
Das klingt mehr nach einer politischen Vision als nach einem Recht, das Studierende demnächst einfordern könnten.
Es ist ein visionäres Ziel. In den nächsten zwei bis drei Jahren wollen wir daran arbeiten.
Wenn wir auf die steigenden Mieten in vielen Hochschulstädten schauen – droht da nicht gerade jetzt eine neue Form sozialer Auslese?
Das darf nicht passieren. Kein Studium darf daran scheitern, dass jemand keine Wohnung findet. Deshalb investieren wir Rekordsummen in den sozialen Wohnungsbau. Das Programm "Junges Wohnen" spielt dabei eine wichtige Rolle.
"Die Verdoppelung der Bundesmittel fürs "Junge Wohnen"
ist ab 2027 fest eingeplant."
Die Koalition hat versprochen, die Programm-Mittel zu verdoppeln.
Ja, von 500 Millionen auf eine Milliarde Euro pro Jahr – das ist ein starkes Signal. Die Mittel für den sozialen Wohnungsbau insgesamt steigen Jahr für Jahr: 2026 auf vier Milliarden Euro, 2027 auf fünf Milliarden, 2028 und 2029 auf 5,5 Milliarden. Darin ist das "Junge Wohnen" enthalten, die Verdopplung ist ab 2027 fest eingeplant. Das heißt, dass auch die Länder dann mehr investieren müssen. Da gibt es keine Ausreden mehr.
Im Augenblick reichen die Absichtserklärungen nur bis 2029. Und danach?
Die Mittel sind bis 2029 gesichert. Aber klar ist: Das Wohnungsproblem lösen wir in vier Jahren nicht. Deshalb müssen wir Tempo machen – mit dem Bau-Turbo. Parallel fördern wir auch den frei finanzierten Wohnungsbau mit elf Milliarden Euro aus dem Sondervermögen des Bundes. Wenn der Druck auf den Markt sinkt, profitieren alle, auch Studierende.
"Der Bau-Turbo ist tatsachlich mutig – eine Art Brechstange.
Statt fünf Jahre dauert ein Bebauungsplan künftig nur noch drei Monate."
Das Bau-Turbo-Gesetz hat die Bundesregierung gerade durchs Parlament gebracht. Im Koalitionsvertrag heißt es, Deutschland müsse "mutige Wege" bei Planungs-, Bau- und Verwaltungsverfahren gehen. Machen Sie doch einmal konkret, was das heißt.
Der Bau-Turbo ist tatsächlich mutig – eine Art Brechstange. Statt fünf Jahre dauert ein Bebauungsplan künftig nur noch drei Monate. Gemeinden dürfen von Vorgaben abweichen und schneller entscheiden: aufstocken, nachverdichten, Baulücken schließen. So entsteht neuer Wohnraum – auch für Studierende. In Berlin etwa kann man alte Beschränkungen wie die Traufhöhen-Regel aus der Kaiserzeit nun flexibler handhaben.
Die Umsetzung hängt also stark von den Gemeinden ab. Wie wollen Sie die zu mehr Tempo bewegen?
Wir haben parallel zum Gesetz ein Umsetzungslabor gestartet. Beim digitalen Auftakt waren 2.500 "Möglichmacherinnen und Möglichmacher" aus ganz Deutschland dabei – Leute, die den Bau-Turbo umsetzen und voneinander lernen wollen. Ich komme aus dem Start-up-Bereich: Gesetze dürfen nicht jahrelang ungenutzt bleiben.
Apropos umsetzen: Im Koalitionsvertrag ist auch vom seriellen, modularen, systemischen Bauen die Rede.
Wir bauen in Deutschland zu langsam und zu teuer, das müssen wir ändern. Serielles Bauen funktioniert ähnlich wie in der Automobilindustrie: Ein Auto wird ja nicht in der Werkstatt oder beim Kunden zusammengeschraubt, sondern in einer Fabrik. So kann man auch Häuser planen: industriell, effizient und in hoher Qualität.
Da denken womöglich viele an DDR-Plattenbau.
Nein, das kann auch schön sein. Wände oder ganze Module – etwa Studierendenapartments – werden in der Fabrik vorgefertigt und vor Ort in wenigen Tagen montiert. Das spart Zeit und Kosten und eignet sich auch für Sanierungen. In Ilmenau wurde so bereits ein Studierendenwohnheim modernisiert – über das Programm "Junges Wohnen".
Wenn man dieses Prinzip aber auf Hochschulen oder Schulen überträgt – droht da nicht doch eine uniforme Architektur, wo eigentlich inspirierende Lernorte entstehen sollten?
Ganz und gar nicht! Nur weil das Innenleben standardisiert ist, muss die Architektur nicht eintönig sein. Fassade, Ästhetik und Baukultur bleiben individuell gestaltbar. Ich habe viele seriell errichtete Gebäude gesehen – man erkennt den Unterschied nicht. Architektinnen und Architekten sind Teil des Prozesses und sorgen dafür, dass die Gebäude schön und funktional sind.
Lassen Sie uns nochmal über Geld reden. Wenn das Programm "Junges Wohnen" wächst, ist das gut, aber es fließt auch an private Investoren, die im Gegenzug zum Beispiel Wohnheime mit Mietpreisbindung bauen. Doch die läuft irgendwann aus – mit der Konsequenz, dass der Wohnraum für Studierende dann wieder verlorengeht?
Wir müssen kreativ sein, wie öffentliche Mittel eingesetzt werden. Etwa die Hälfte der geförderten Projekte liegt ohnehin bei gemeinwohlorientierten Trägern – Studierendenwerken, kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften. Wichtig ist, dass wir das Gesamtvolumen an Fördermitteln massiv erhöhen – und so Vielfalt im Angebot schaffen. Die Belegungsbindung würde ich gern entfristen, aber das ist rechtlich nicht möglich.
Studentischer Wohnheimbau gilt bei privaten Investoren als lukratives Geschäft.
Aber nicht alle privaten Investoren sind böse Kapitalisten. Es gibt viele, die langfristig und verantwortungsvoll investieren.
Hinzu kommen die hohen Baukosten. Ist der vieldiskutierte "Gebäudetyp E" die Lösung?
Der Gebäudetyp E – E wie einfach oder effizient – ist ein wichtiger Schritt, um günstiger zu bauen. In Deutschland gibt es sehr viele Bauvorschriften und technische Normen, manche davon sind überzogen. Wir wollen pragmatischer werden: weniger Bürokratie, mehr Freiraum. Natürlich braucht es Rechtssicherheit, wenn Bauherr und Käuferin von Normen abweichen – daran arbeiten wir mit dem Justizministerium. So lassen sich enorme Kosten sparen, etwa bei Material oder Wandstärken. Manche deutschen Wände sind dicker als an der Champs-Élysées – das muss wirklich nicht sein.
Also künftig Champs-Élysées-Wände als Maximalstandard?
(Lacht) Nein, es geht nicht um Luxus, sondern um Pragmatismus. Wir Deutschen sind Bürokratieweltmeister. Ich war mit meiner Vorgängerin Klara Geywitz in einem Gebäude nach Typ E – man merkt nicht, dass dort auf Schnickschnack verzichtet wurde. Im Gegenteil: Ein bisschen back to the roots tut gut.
Aber ist das alles nur verzichtbarer Schnickschnack? Gerade junge Menschen legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wird unter dem Label Entbürokratisierung und Kostensenkung am Ende weniger Klimaschutz betrieben?
Nein, auf keinen Fall. Weder Klimaschutz noch Sicherheit werden aufgeweicht. Brandschutz und Statik bleiben unangetastet. Im Gegenteil: Der Gebäudesektor ist für 30 bis 40 Prozent der CO₂-Emissionen verantwortlich – wir müssen da aufholen. Beim Neubau gilt weiterhin mindestens der KfW-55-Standard. Der Gebäudetyp E ändert daran nichts. Viele solcher Gebäude entstehen sogar in Holzbauweise – nachhaltiger und günstiger zugleich.
Apropos Aufholen: Die Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie steht an. Was kommt da auf uns zu?
Das ist eine große Aufgabe. Wir müssen Sanierungsquoten erfüllen und Solardächer verpflichtend machen. Daran arbeite ich mit Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche.
Die Frist ist doch durch die EU vorgegeben: bis Mai 2026.
Schon richtig. Deutschland hat derzeit dutzende Vertragsverletzungsverfahren wegen Fristverletzung am Laufen – wir wollen das in dem Fall natürlich verhindern.
Also nicht das nächste Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland?
Uns ist klar, dass die Umsetzung gelingen muss – Vertragsverletzungsverfahren sind teuer und kosten nicht nur Geld, sondern auch Glaubwürdigkeit. Wir wollen zeigen, dass Deutschland europäische Vorgaben ernst nimmt, aber sie auch praxistauglich umsetzt.
EU-Richtlinien bedeuten aber auch finanzielle Mehrbelastungen – etwa für Studierendenwerke, die als gemeinwohlorientierte Träger keine Gewinne erwirtschaften und Sanierungen nicht selbst stemmen können.
Das sehen wir natürlich. Es gibt große Förderprogramme wie die BEG-Förderung für Sanierungen. Aber das eigentliche Thema ist die Finanzbeziehung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Mit dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Zukunftspakt wollen wir sicherstellen, dass die Kommunen finanziell leistungsfähig bleiben und werden. Für die Hochschulen sind wiederum die Länder zuständig, sie erhalten ihrerseits aus dem Sondervermögen 100 Milliarden Euro, inklusive einer neuen Verschuldungsmöglichkeit, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können. Das war ein historischer Schritt. Wichtig ist, dass keine Ebene – weder Bund noch Länder oder Kommunen – durch Klimaschutzanforderungen überfordert wird. Und dann können wir auch Träger wie die Studierendenwerke angemessen unterstützen.
Die 100 Milliarden Euro für die Länder aus dem Sondervermögen sind extrem umkämpft. Gerade im Hochschulbau ist der Sanierungsrückstau gewaltig. Kommt da genug an?
Diese Erwartung müssten Sie an meine Kollegin Dorothee Bär im Forschungsministerium richten. Ich habe gehört, sie steht mit den zuständigen Landesministerinnen und Landesministern in einem engen Austausch. Klar ist: Die 100 Milliarden reichen nicht für all die Aufgaben in den Ländern. Deshalb habe ich auf die neue Verschuldungsmöglichkeit hingewiesen – und darauf, dass der Zukunftspakt erweitert werden muss, damit sich auch die Hochschulen weiterentwickeln können. Dafür müssen wir ans Herzstück unserer Demokratie: Wie beschließen wir mutiger Reformen, bündeln Kompetenzen? Nicht im Bildungsbereich allein – viele Prozesse dauern zu lange, weil immer jemand anderes zuständig ist. Gut, dass mit Karsten Wildberger ein Kabinettskollege die Staatsmodernisierung vorantreibt und neue Wege geht.
Die Länder erhalten außerdem jährlich eine Milliarde Euro als Ausgleich für den Investitionsbooster. Bisher sollten davon 940 Millionen in Kitas fließen – und gerade einmal 60 Millionen in Hochschul- und Forschungsbau. Das soll es dann von Bundesseite gewesen sein?
Natürlich reicht das nicht. Aber die Bedarfe sind überall groß, vor allem bei der Kinderbetreuung. Es geht um Vereinbarkeit, um frühkindliche Bildung, die Basis späterer Bildungswege.
"Das ist Demokratie: Sie produziert Kompromisse
und nicht immer Begeisterung."
Jetzt soll den Ländern die Aufteilung ihres Anteils an der Milliarde jeweils nach Bedarf überlassen werden. Ist es glücklich, wenn man die Bedarfe der jungen Generation auf diese Weise gegeneinander ausspielt?
Das ist Demokratie: Sie produziert Kompromisse und nicht immer Begeisterung. Ich finde es wichtig, dass die Hochschulen überhaupt dabei sind – was, wenn wir nur die Kitas berücksichtigt hätten? Natürlich wünsche ich mir mehr Geld. Dann müssen wir aber auch über Einnahmen und Ausgaben sprechen. Als Unternehmerin sage ich: Sparen gehört dazu. Es gibt aber auch Bereiche wie die Erbschaftsteuer mit Schlupflöchern. Starke Schultern könnten mehr tragen. Dafür stehe ich als Sozialdemokratin: Aufstieg gelingt, wenn die, die können, mehr beitragen. Ich würde aber gern auch noch über Forschung reden.
Bitte schön.
Es passiert ja auch noch etwas jenseits des Sondervermögens. Als Bundesbauministerium planen wir gerade ein neues Bundesforschungszentrum für klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen (BFZ), zunächst zusammen mit Thüringen, Sachsen und Baden-Württemberg. Dafür nehmen wir fast vier Millionen Euro pro Jahr in die Hand. Die Bauforschung ist bislang unterrepräsentiert in Deutschland, das ändern wir mit dem BFZ, das innovativ als Forschungsverbund konstruiert wird, offen für weitere Länder.
Wann geht es damit los?
Wir hoffen, nächstes Jahr. Es geht um Nachhaltigkeit, neue Materialien, Vernetzung und regionale Kompetenzbündel. Regionen wie Bautzen zeigen, wie Transformation gelingt: Wo früher Kohle war, entsteht Zukunft – nachhaltiges Bauen als Motor für Innovation, Wirtschaftskraft und neues Unternehmertum.
Spricht da die frühere Start-up-Gründerin? Die meisten Studierenden und Absolvent*innen wünschen sich vor allem einen sicheren Job.
Deutschland ist eher risikoavers. Als ich gegründet habe, fragten alle: Warum sollte das klappen? In den USA heißt es: Warum nicht?
Sie haben mit einer Studienkollegin gegründet.
Ja, mit 25. Ich war nie Angestellte, wurde direkt Arbeitgeberin, am Ende mit 60 Mitarbeitenden. Wichtig sind Role Models – Menschen, die in Schulen und Hochschulen zeigen, wie Selbstständigkeit funktioniert. Erfolg ist selten gradlinig: 99 Prozent Mühe, 1 Prozent Glanz. Als ich an der WHU den Zalando-Gründer hörte, sagte der: "99 Prozent der Zeit ist hart, aber das eine Prozent ist großartig – ihr lernt enorm viel und bewegt etwas." Das entzaubert die Hürde. Hochschulen wie die TU München oder die RWTH Aachen fördern Unternehmertum gezielt. Und Selbstständigkeit heißt nicht nur Start-up – auch Handwerk oder Medizin sind Unternehmertum. Kaum jemand steht mit acht Jahren auf und sagt: "Ich werde Unternehmer" – außer vielleicht Christian Lindner. Aber wer es wagt, erlebt eine steile Lernkurve und viel Freiheit. Mein Rat: Traut euch! Und gerade als Studierende ist Gründen oft einfacher: niedriger Lebensstandard, weniger Verpflichtungen, man schlängelt sich durch. Im schlimmsten Fall sucht Ihr Euch danach einen Job.
Also: je früher gründen, desto besser?
Absolut. Mein Votum für studentisches Gründen steht.
Interview: Jan-Martin Wiarda. Zuerst erschienen im DSW-Journal 4-2025.
Kommentare
#1 - wir bauen in deutschland zu langsam, zu teuer...
ohne neue VOB, LBO s, DIN und ohne digitalisierung der baueingabe,-planung etc. und ohne automatisierung der vorfertigung, roboterisierung der bauausführung wird bauturbo zum bauschlamassl...lösungen siehe hier: www.rod.de
#2 - Sozialwohnungen für Studierende?
Ich verstehe nicht, was die Förderung des sozialen Wohnungsbaus mit Studierenden zu tun hat - so lange diese grundsätzlich BAföG-berechtigt sind, bekommen sie doch gar keinen Wohnberechtigungsschein?
#3 - BauTurbo - BPlan
Der sog. BauTurbo ermöglicht mitnichten einen Bebauungsplan im Sinne einer verbindlichen Satzung (§10 BauGB) innerhalb von drei Monaten, ggfs. einen "Bauplan" im Sinne Erschließungs- und Aufteilungsplan. Traurig das selbst die zuständige Bundesministerin offenbar den Unterschied nicht kennt....





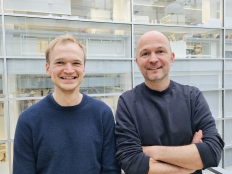


Neuen Kommentar hinzufügen