"Stunde Null"?
Mit einem neuen Verhaltenskodex reagiert der Historikerverband auf strukturelle Probleme in der Promotionsbetreuung. Die Empfehlungen reichen von Betreuungslimits bis zu Ombudsstellen – und zeigen, wie tief die Defizite im Wissenschaftssystem reichen.

Bild: Pexels / pixabay.
Mir ging es wie dem deutsch-amerikanischen Ökonomen Rudi Bachmann, als ich zum ersten Mal vom Mitte Mai beschlossenen Verhaltenskodex des Historikerverbandes hörte. Der ZEIT-Newsletter "Wissen3" berichtete am Montag darüber, sprach von einer potenziellen "Stunde Null" in der geschichtswissenschaftlichen Fächerkultur: Das verabschiedete Leitbild habe es in sich.
"Gerade gelesen", postete Bachmann daraufhin auf "X". "Die deutschen Historiker wollen die Zahl der DoktorandInnen pro Prof auf 10 (!!!) begrenzen. Um Machtmissbrauch zu begrenzen." Und weiter: "10? Wie soll man selbst 10 DoktorandInnen wirklich adäquat betreuen? Das ist doch nicht seriös." Auf die Frage Bachmanns kann man nur entgegnen: Es gibt keinen Grund und keine Rechtfertigung, egal in welchem Fach, eine derart große Zahl von Doktoranden parallel zu haben. Nicht zehn und erst recht nicht noch mehr.
Es ist, wie der Historikerverband es in seinem Leitbild "Machtmissbrauch in der Geschichtswissenschaft verhindern" formuliert: "Eine fach- und personengerechte Betreuung und Förderung ist für Betreuer:innen zeitaufwändig und arbeitsintensiv. Eine nur formale Übernahme solcher Betreuungspflichten führt zwangsläufig zu unklaren Verantwortlichkeiten und eröffnet dem Machtmissbrauch (in Form einer Erschleichung von Reputationsgewinnen, Monopolisierung und Kontrolle von Forschungsfeldern) Tür und Tor."
Dass der Historikerverband sich trotzdem lediglich auf die zehn als Obergrenze festlegen konnte, zeigt, wie groß die Widerstände selbst gegen diese immer noch viel zu laxe Empfehlung waren – was wiederum die Tragweite des Kodex als "Stunde Null" dann doch in Frage stellt.
Wenn der Verband außerdem und zu Recht empfiehlt, "die Aufgaben von Betreuer:innen und Gutachter:innen in Promotionsverfahren personell zu trennen", dann sollte man innehalten und sich fragen, was die Einforderung von Grundsätzen, die längst selbstverständlich sein sollten, über die Wirklichkeit deutscher Hochschulen weit über die Geschichtswissenschaften hinaus aussagt.
Lange Mängelliste
Die Antwort findet man in der Umfrage des Verbands, die vor der Verabschiedung des Leitbilds stattgefunden hatte. "Die Mängelliste des Fehlverhaltens ist lang und die Meldehäufigkeit zum Teil erschreckend", heißt es darin: "Implizite Drohung bzw. Einschüchterung" meldeten 56 Prozent der Antwortenden, "Wutanfälle" 29 Prozent, von "feindselig-aggressivem Verhalten" berichteten 37 Prozent.
Wegen "ethnischer Zugehörigkeit oder rassistischer Zuschreibung" diskriminiert benannten sich 14 Prozent, wegen ihrer sozialen Herkunft und wegen ihres Alters sind es jeweils 19 Prozent. Und: Gefragt nach der erfahrenen institutionellen Unterstützung bei Übergriffen und Fällen von Machtmissbrauch, sagten nur 33 Prozent: Ja, gab es.
Die Maßnahmen, die der Historikerverband sonst noch empfiehlt, sind so vielfältig wie die Misstands-Meldungen: Betreuungsvereinbarungen, regelmäßige und möglichst schriftlich festgehaltene Gespräche, Mentoring, universitätsweite Ombudsstellen und Vertrauenspersonen auf Fächerebene, mehr Dauerstellen und Tenure-Track für den Mittelbau. Und vor allem klare Regeln, Schulungen, Selbstreflexion der Vorgesetzten.
Gut, dass der Historikerverband mit der Umfrage und dem neuen Leitbild transparent die Schieflage angehen will. Etwas, das man sich von vielen anderen Fachgesellschaften genauso wünschen würde. Je mehr Maßnahmen in dem Papier man liest, umso deutlicher spürt man allerdings auch, welch weiten Weg die Hochschulen noch zu gehen haben.
Kommentare
#1 - Letzte Bastion
Die Historiker erscheinen mir an den Universitäten in vieler Hinsicht oft wie die letzte Bastion der "alten Universitäten" (prä 1970er). Lehrstühle mit entsprechenden Hierarchien, isolierte Fachkulturen, Ablehnung von Bologna, Hüter der reinen Geisteswissenschaften, viele habilitierte PDs in akademischer Reserve...
Insofern überraschen die eigenen Befunde nicht - aber es ist gut, dass sie überhaupt diesen reflexiven Blick gewagt haben.
#2 - Doktoranden
Die genannten Probleme scheinen mir hausgemacht zu sein, aber nicht primär von den Geschichts-Professoren, sondern von jenen Kräften, die immer größere Teile des universitären Personals durch Drittmittel finanziert sehen wollen, so eben auch Doktorandenstellen. Drittmittel bringen Geld und auch Prestige, das ist in allen Fächern so. In den Ingenieurfächern ist es übrigens nicht selten, dass ein Institut mit einem Professor als Leiter 50 Leute beschäftigt, die meisten als Doktoranden aus Drittmitteln. Nach der Promotion gehen sie in die Industrie. Das ist eine win-win-Situation: Der Institutsleiter ist dann bei der Hochschulleitung besonders angesehen, sein Prestige strahlt bis in die Industrie aus, und diese Promovenden können sich auch etwas darin sonnen, weil sie "aus dem richtigen Stall" kommen. Beim Fach Betriebswirtschaft werden sie dann z.B. Vorstands-Assistenten, eine Kaderschmiede für Vorstands-Mitglieder.
Früher hatte ein Ordinarius in den Geisteswissenschaften vielleicht 1-2 Assistenten, die an seinem Lehrstuhl promovierten und danach noch einige Jahre blieben, sie konnten z.B. habilitieren und sich auf eine Rolle als Dozent vorbereiten, z.B. durch Lehrstuhlvertretungen oder Gastdozenturen. Heute muss alles beantragt werden, Drittmittel sind Trumpf, Sonder-forschungs-bereiche, Graduiertenkollegs, Exzellenzcluster usw., und Doktorandenstellen sind nicht selten auf 2 Jahre befristet. Für eine Verlängerung muss wieder ein Antrag mit einem Zwischenbericht eingereicht werden. Die Bürokratie gedeiht, und wer schreibt die vielen Anträge, wer begutachtet sie? Genau: diejenigen, die eigentlich ihre Doktoranden betreuen sollten.
Fragt sich noch, was das typischerweise für Leute sind, die uns diese Multi-Funktionärs Professoren als Vorbilder hingestellt haben. Hat jemand eine Idee?
#4 - Seltsame Initiative
Mir ist völlig unklar, welche Verbindung zwischen dem gemeldeten Fehlverhalten (Wutanfälle, Diskriminierung) und der Zahl von Doktoranden bestehen soll. Vermutlich, weil es keine gibt.
Auch sonst würde ich keinem Wort hier zustimmen. Weshalb haben einzelne Profs viele Doktoranden? Weil die Leute bei diesen Profs promovieren wollen, weil sie deren Arbeit fasziniert, weil sie ein Thema erschließen wollen, dass diese Profs auch bearbeiten, weil diese Profs vielleicht auch Mittel haben (Drittmittel, die sie haben müssen und ausgeben müssen - was aber eigentlich nichts mit Doktoranden zu tun hat, sondern mit der "unternehmerischen Universität"...)
Dass ausgerechnet dieselben Profs meist sehr wenig Zeit haben - das gehört zu den Tücken des Systems. Was wäre die Lösung? Die Doktoranden bürokratisch verwalten und zu Profs der zweiten und dritten Reihe umverteilen? (Schreien die übrigens weniger, sind sie weniger übergriffig? Das müsste man doch erst erhärten.) Oder Promotionen verhindern? Das ist doch überhaupt nicht auf Linie mit der Politik, die zum Ziel hat,so viele Doktoranden wir möglich zu produzieren (Stichwort Grakos).
Sicher ist: wer bei einem dieser Profs mit vielen Doktoranden promovieren will, dem muss klar sein, dass er fähig sein muss, sich faktisch selbst zu promovieren. Das war immer so.
Für mich klingt diese Initiative nach der üblichen Mischung aus neuer Gefühligkeit, Promotionsfrust und Neid unter Profs. Ist halt auch blöd, wenn der Unsympath im Nachbarbüro 15 Doktoranden hat und man selbst den Absolventen hinterherläuft - keine Frage.





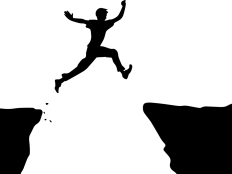
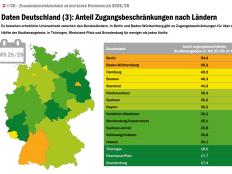

Neuen Kommentar hinzufügen