Die Exzellenzstrategie ist nicht das Problem – sie zeigt das Problem
Ein Essay über den Nebenschauplatz, den viele zur Hauptsache machen – und die eigentliche Debatte über Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit, die Politik und Wissenschaft lieber meiden.
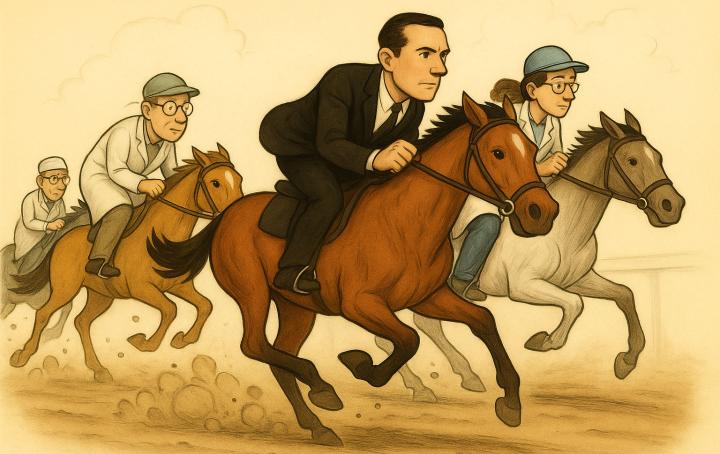
Illustration KI-generiert.
DIE WOCHEN 1 UND 2 nach der Exzellenzcluster-Kür brachten die üblichen Debatten, nachvollziehbar auch in der Kommentarleiste hier im Blog. Das Förder-Missverhältnis zulasten der Geistes- und Sozialwissenschaften sei "katastrophal", Aufwand und Ertrag stünden bei der ExStra "in keinem irgendwie nachvollziehbaren Verhältnis"; mancher raunte gar, die Entscheidungen seien ohnehin "politisch" motiviert gewesen, nicht wissenschaftlich.
Zur Frage der Fächerverteilung gibt es von der DFG jetzt erste statistische Anhaltspunkte, die zumindest die Schlussfolgerung zulassen, dass sich hier nicht mehr viel verschoben hat. Der Vorwurf eines politischen Geschiebes wiederum mag 2018 berechtigt gewesen sein. Dieses Jahr allerdings war er es so wenig, dass man umgekehrt sogar fragen könnte, ob nicht etwas mehr politischer Einfluss gerechtfertigt gewesen wäre angesichts der Vergabe von 3,8 Milliarden Euro an Steuermitteln über die nächsten sieben Jahre.
"#IchbinHanna"-Initiatorin Amrei Bahr schrieb unterdessen von der "großen Exzellenzinszenierung" und kommentierte: "Es weckt Zweifel, wenn das Antrags-Game mitsamt seinen teils fragwürdigen Spielregeln den Beteiligten aufnötigt, zu PR-Strateg_innen für ihr Forschungsvorhaben zu werden, die der Vermarktung gegenüber wissenschaftlicher Redlichkeit den Vorzug geben müssen."
Auch dies trotz ihrer bestechenden Klarheit keine neue Kritik und wie fast alle erwähnten Aspekte teilweise schon mehrfach öffentlich durchdiskutiert, auch in diesem Blog. Genau wie die alles verbindende Frage, ob die Abschaffung der Exzellenzstrategie vielleicht doch die beste Strategie zur Steigerung wissenschaftlicher Exzellenz und Integrität an deutschen Hochschulen sein könnte.
Programm mit ungesicherter Zukunft
Dass die langfristige Zukunft der "ExStra" trotz aller Beteuerungen alles andere als gesichert ist, zeigt die Beflissenheit, mit der Wissenschaftsministerinnen und Wissenschaftsminister, auch aus erfolgreichen Bundesländern, nach der Cluster-Entscheidung auf die geplante Vorverlegung der Evaluation des Programms verwiesen: Eigentlich war sie laut Bund-Länder-Vereinbarung erst für 2035 vorgesehen, doch der schwarz-rote Koalitionsvertrag machte sie kurzerhand zur Voraussetzung für "eine mögliche Förderperiode ab 2030 " – und schob sie damit um satte sieben Jahre nach vorn.
Unterdessen interessiert die Rektorate derjenigen Universitäten, die genug Cluster zusammenbekamen, aber bislang nicht Exzellenzstatus haben, derzeit ausschließlich die nahe Zukunft und dabei konkret die Frage, ob und wie sie diesen nächstes Jahr bekommen können: Sind die Chancen allein größer oder im Verbund? Müssen sie noch mehr "Impact", DAS wissenschaftspolitische Buzzword dieser Tage, in ihren Antrag für die zweite Förderlinie schreiben? Und, vielleicht am skurrilsten: Müssen sie sich Sorgen machen, wenn sie bei den errungenen Clustern nicht überall federführender Antragsteller waren? Die Antwort: natürlich nicht. Die Cluster zählen alle gleich, es kommt auf die Stärke und Stimmigkeit des Bewerbungskonzepts als Ganzes an.
Den spannendsten, da für mich überraschendsten Debattenbeitrag lieferte für mich aber ein Mann, der gerade erst in der Wissenschaftspolitik angekommen ist und trotzdem über reichlich wissenschaftspolitische Erfahrung verfügt: Karl Lauterbach, nach seinem Abschied als Gesundheitsminister von der SPD zum Vorsitzenden des neu benannten Ausschusses für Forschung, Technologie und Raumfahrt gemacht.
Auf die Frage im Tagesspiegel-Interview, ob die deutsche Forschungslandschaft von Trumps Attacke auf US-Wissenschaftsstandorte wie Harvard profitieren könne, antwortete Lauterbach, der selbst in Harvard studiert und gelehrt hat, das glaube er "insgesamt eher nicht". US-Top-Wissenschaftlern solle Deutschland zwar "auf jeden Fall Angebote machen, damit sie ihre Forschung weiterführen können. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir weit davon entfernt sind, ähnliche Arbeitsbedingungen anbieten zu können, wie sie etwa in Harvard herrschen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass diese Forscher hier genauso funktionieren würden wie dort. Dazu haben wir weder das Geld noch die Infrastruktur. Und auch nicht die Verknüpfung von Forschung und Ökonomie."
Eine illusionsfreie Bestandsaufnahme, die sich wohltuend abhob von der Selbstberauschtheit, mit der zum Beispiel Kulturstaatsminister Wolfram Weimer neulich – noch dazu komplett ohne Substanz – Harvard einen deutschen "Exil-Campus" vorgeschlagen hatte. Woraufhin Dorothee Bärs BMFTR auf Anfrage die Exzellenzcluster-Vergabe als Beleg für Deutschlands internationale Attraktivität als Forschungsstandort anführte.
Harvard und Yale sind nicht der Maßstab
Auch Lauterbach kam in seinem Tagesspiegel-Interview auf die Exzellenzstrategie zu sprechen: Deutschland verteile viel Geld "auch mit der Gießkanne, weil wir viele Standorte haben. Da ist die Exzellenzinitiative (sic!) eine lobenswerte Ausnahme." Wobei man sich fragen müsse, ob 70 Standorte nicht zu viele seien, und setzte die Dinge in den richtigen Maßstab: "Harvard allein verliert jetzt so viel Geld aus Bundesmitteln, wie die Exzellenzinitiative für 70 Standorte in mehreren Jahren ausgibt. Geld ist, neben der Wissenschaftsfreiheit und einer Entbürokratisierung, der wichtigste Faktor."
Sätze, die mich an ein Interview erinnerten, das ich 2016 für die ZEIT mit dem damaligen Stanford-Präsidenten geführt habe. Die halbe Milliarde Euro pro Jahr, die damals in die deutsche Exzellenzinitiative flossen, entsprachen laut John Hennessy "dem jährlichen Budget einer unserer sieben Fakultäten." Und trotzdem, sagte Hennessy, habe man nicht genug Geld für Spitzenforschung, weshalb "wir uns beschränken. Bei uns gilt die Devise: Wenn wir etwas nicht auf einem absoluten Spitzenniveau tun können, dann lassen wir es lieber."
In einem Punkt unterschied sich Hennessys Einschätzung allerdings von der Lauterbachs. Der deutsche Gesundheitsökonom sagte im Tagesspiegel, man müsse sich in Hinblick auf die Exzellenzstrategie fragen, "ob wir auf diesem Weg weitergehen wollen, oder ob wir nicht versuchen wollen, zu den globalen Spitzenuniversitäten aufzuschließen."
Während Hennessy vor neun Jahren sagte, Harvard, Yale oder Stanford seien für die deutschen Universitäten "die falschen Vorbilder. Was nützt es Ihnen, sich mit Privathochschulen zu vergleichen, die Milliarden an Stiftungskapital haben und von einigen ihrer Studenten 60.000 Dollar Studiengebühren nehmen können? Schauen Sie sich lieber die besten staatlichen US-Universitäten an, Berkeley, Michigan, Chapel Hill."
Weder Positiv-Beleg noch Negativ-Beispiel
Was folgt für mich aus alldem? Erstens und vor allem: Nicht die Exzellenzstrategie sollte das Kernthema unserer wissenschaftspolitischen Debatten sein. Sondern ihre Einfassung in ein chronisch unterfinanziertes Gesamtsystem. So, wie unser Hochschul- und Wissenschaftsfinanzierung heute aussieht, ist die Exzellenzstrategie in ihrer Bedeutung, ihrem Impact, komplett überbewertet, denn sie taugt weder als Positiv-Beleg noch als Negativ-Beispiel.
Nicht als Positiv-Beleg dafür, dass Deutschlands Universitäten international in der ersten Liga mitspielen oder gar in der Lage wären, bedrohte Forschende von US-Tophochschulen in Scharen anzulocken. Da gibt es ganz andere und ganz anders finanzierte Adressen in der Welt.
Und nicht als Negativ-Beispiel für die angebliche Schieflage der deutschen Forschungsförderung zulasten der Breite der deutschen Wissenschaft. Dafür ist das "ExStra"-Budget mit 0,75 Prozent der Gesamteinnahmen deutscher Hochschulen (inklusive Hochschulklinika) im Jahr 2024 viel zu gering: 533 Millionen versus 70,9 Milliarden Euro.
Wer fordert, die Exzellenzstrategie abzuschaffen, um mit deren Geld die Breite der Hochschule besser zu finanzieren, begibt sich insofern auf einen absoluten Nebenschauplatz.
Die Ambitionslosigkeit von Politik und Gesellschaft
Daher zweitens: Wir sollten unermüdlich auf die eigentlich notwendige, aber von der Spitzenpolitik stets vermiedene Debatte drängen: warum Deutschlands Politik und Gesellschaft über den wirtschaftlichen Abstieg und die mangelnde Innovationsfähigkeit im Land klagen, zugleich aber derart wenig ambitioniert sind in der Finanzierung der einzigen Aufstiegsoption, die unser rohstoffarmes Land tatsächlich hat: Wissenschaft und Forschung.
Ja, unambitioniert, da hilft auch nicht der Verweis auf die 3,1 Prozent, die Deutschland von seiner Wirtschaftsleistung jedes Jahr in Forschung und Entwicklung investiert. Ein Anteil, der seit vielen Jahren stagniert. Die USA liegen bei 3,6 Prozent (umgerechnet auf Deutschlands BIP entspräche das 23 Milliarden Euro mehr pro Jahr), Südkorea bei 4,8 Prozent (umgerechnet 77 Milliarden mehr), Israel (unglaubliche 144 Milliarden mehr). Nicht vergleichbar, da aus diesem oder jenem Grund Sonderfälle? Vielleicht. Aber Gradmesser sind sie auf jeden Fall. Übrigens auch und gerade für die Privatwirtschaft, denn die trägt in Deutschland traditionell zwei Drittel der F&E-Ausgaben – und müsste, wie der Staat deutlich mehr hinblättern.
Doch zurück zu den Hochschulen, denn hier wird es besonders bitter. Die USA geben 2,5 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für den sogenannten Tertiärbereich aus, Deutschland laut aktueller Auswertung des Statistischen Bundesamts knapp 1,3 Prozent, Tendenz gleichbleibend. Zahlen, in denen wiederum viel Debattenstoff steckt. Denn den großen Unterschied zwischen den deutschen und amerikanischen Werten macht die private Hochschulfinanzierung. Sollten wir nicht auch darüber reden? Ja, die deutsche Hochschullandschaft ist anders gebaut, die staatlichen Hochschulen spielen hier eine viel beherrschendere Rolle. Doch sehen wir gerade im Kampf um die Wissenschaftsfreiheit in den USA, dass es mit Harvard eine reiche Privatuniversität ist, die Trump die Stirn bietet.
Um die deutsche Hochschulfinanzierung – und damit die deutschen Hochschulen als Arbeitgeber für einheimische wie ausländische Forschende – konkurrenzfähig zu machen, brauchen wir in jedem Fall beides: deutlich mehr staatliche Gelder, vor allem für die Grundfinanzierung, und deutlich mehr private Mittel.
Heißt das sozial verträgliche Studiengebühren (ja, das geht)? Mehr Industriedrittmittel statt immer weniger? Mehr selbst generierte Einnahmen der Unis durch eine bessere Verwertung von Forschungsergebnissen? Mehr öffentlich-private Forschungsinstitute? Mehr privates Mäzenatentum, wie es Lidl-Milliardär Dieter Schwarz auf eindrucksvolle, aber in Deutschland auch recht einzigartige Weise in Heilbronn vormacht und wie es Patrick Cramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, in der WELT gefordert hat? Gerade erst hat SAP-Gründer Hasso Plattner angekündigt, hunderte Millionen Euro für einen neuen Campus der Universität Potsdam zu spendieren und für mehr Forschung vor allem zu Künstlicher Intelligenz, übrigens mit dem expliziten Hinweis auf die USA: "Wir haben eine historische Chance, in den nächsten dreieinhalb Jahren aufzuholen." So bemerkenswert das ist, brauchen wir nicht ein Vielfaches solcher Projekte überall in Deutschland?
Auch wenn viele schon die Frage schwierig finden, ja sie demonstrativ ablehnen werden: Wer ernsthaft die Unterfinanzierung der deutschen Hochschulen beklagt, wird auch solche Debatten führen müssen. Manche allerdings, steht zu befürchten, begeben sich stattdessen lieber wieder auf Nebenschauplätze.
Wie die Exzellenzstrategie dann aussehen könnte
Was nicht heißt, dass wir nicht, drittens, über die Zukunft der Exzellenzstrategie reden müssen. Meine These: Mit besserer staatlicher Grundfinanzierung müssten Hochschulleitungen Exzellenzgelder nicht mehr zum Stopfen von Löchern verwenden. Die ExStra würde nicht mehr die Spaltung innerhalb der Universitäten in geförderte und nicht geförderte Bereiche vertiefen – und privates Engagement könnte wachsen.
Dann könnte die Exzellenzstrategie doppelt anders aussehen, und zwar so ähnlich, wie Karl Lauterbach es sagt: höher dotiert und stärker konzentriert. Die Zahl der Cluster kann bei 70 bleiben, um Breitenwirkung zu erzielen. Aber bei den Exzellenzuniversitäten braucht es eine Reduktion – auf vier bis fünf. Aus naheliegenden Gründen.
Zum einen: In Deutschland gibt es nur gut 80 vollwertige Universitäten, wer wollte da ernsthaft behaupten, es wäre inhaltlich gerechtfertigt, demnächst wahrscheinlich 15 davon, also mehr als jede sechste, als in der Gesamtbetrachtung exzellent, also international führend, zu labeln? Tatsächlich hätten wir es lediglich mit einer weiteren Inflation von Begriffen wie "Spitzenforschung" und "Exzellenz" zu tun.
Zum anderen: Nur bei einer ausreichend kleinen Zahl könnte die Fördersumme pro Institution (sie müsste bei mindestens 200, eher bei 500 Millionen Euro pro Jahr liegen) ausreichend groß sein, um sie wirklich von Grund auf zu verändern, ja auf eine andere strategische Ebene zu heben. Ganz im Sinne der von Hennessy angemahnten Beschränkung auf wenige, aber dann wirklich international konkurrenzfähige Forschungsbereiche – zusätzlich zur weiterlaufenden Normalfinanzierung durch Länder und Bund wohlgemerkt.
Dafür müsste sich auch die Entscheidungsfindung ändern. Die Exzellenzcluster würden wie bislang wissenschaftsgeleitet vergeben in einem Verfahren, das auf Grundlage der geplanten Evaluation weiterentwickelt werden könnte. Die Auswahl der Exzellenzuniversitäten müsste allerdings tatsächlich aus der Wissenschaft in die Politik hineinwandern. Der Bund müsste sich mit den Ländern darauf einigen, diese vier oder fünf Standorte aufgrund ihres nachgewiesenen langfristigen wissenschaftlichen Potenzials und der bundesweiten Bedeutung dauerhaft und herausgehoben zu fördern.
Zu diesem Zweck müsste es andere möglichst objektivierbare Evaluationsinstrumente geben, wobei man auf Überlegungen der Imboden-Kommission aufbauen könnte. Auch die Governance dieser Exzellenz-Universitäten müsste sich aufgrund der enormen Bedeutung von Bundesgeldern ändern, zu Bund-Länder-Mischeinrichtungen. International besetzte wissenschaftliche Beiräte, ausgestattet mit Budgethoheit über Teile der Exzellenzgelder, würden eine ständige und zugleich unabhängige Evaluation und Beratung ermöglichen.
All das ähnelt einem Modell von "Leuchttürmen" der deutschen Hochschullandschaft, das so ähnlich einst am Anfang der Überlegungen zur Exzellenzinitiative gestanden hatte. Bevor der Föderalismus zuschlug. Das hier vorgeschlagene Modell könnte die Grundidee von damals mit der gewachsenen Cluster-Tradition verbinden, seit der Föderalismusreform 2014 wäre es rechtlich möglich. Und es würde, bei allen berechtigten Forderungen nach einer stärkeren privaten Beteiligung an der Hochschulfinanzierung, doch die anders gestrickte, stärker öffentlich orientiert deutsche Universitätskultur berücksichtigen.
Klar ist: Drittens geht nicht ohne zweitens. Also eine aussichtslose Debatte, finanzpolitisch wie föderalismustheoretisch? Vielleicht. Aber auf jeden Fall eine spannendere als die immer gleichen, reflexartigen Diskussionen über die Exzellenzstrategie und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wissenschaft, wie sie uns gerade wieder vorgeführt wird.
Kommentare
#1 - Dass es dringend eine bessere Grundfinanzierung braucht: d'accor
Dass es dringend eine bessere Grundfinanzierung braucht: d'accord. Das Argument, die ExStra sei kein Negativ-Beispiel, das die "Schieflage der deutschen Forschungsförderung" zeige, leuchtet mir aber nicht ganz ein, wenn dabei nur das ExStra-Budget berücksichtigt wird und nicht die Gesamtkosten für die Antragstellung mit einberechnet werden. Das Netzwerk Nachhaltige Wissenschaft hat nicht ohne Grund bei DFG und Wissenschaftsrat angefragt, welche Kosten an den Universitäten für die Antragstellung anfallen (und die Antwort erhalten, dass dies nicht erhoben werde, s.
https://netzwerk-nachhaltige-wissenschaft.de/?p=449). Dass es dringend mehr Grundfinanzierung geben muss, ist die eine Sache -- eine weitere ist aber das Binden von Kosten, Zeit und Ressourcen in kompetitiven Verfahren, von denen die ExStra in der Tat nur eines von vielen Beispielen ist. Diese Fehlallokation scheint mir das Hauptproblem zu sein, das man -- und auch da stimme ich Ihnen zu --, grundsätzlich auch über einzelne Programme hinaus diskutieren muss. Dabei sollte die Diagnose des Wissenschaftsrats von 2023, das aktuelle System der Forschungsfinanzierung sei an seine Grenzen
gelangt und es bedürfe einer Neujustierung von Grund- und Projektfinanzierung, durchaus ernst genommen werden. Und zwar auch über den Vorschlag des Wissenschaftsrats hinaus, die Overheads zu erhöhen, denn auch dieser Vorschlag spielt sich weiterhin innerhalb der Logik der Projektförderung ab.
#2 - Die Chance auf eine Realisierung der ursprünglichen Ideen echter
Die Chance auf eine Realisierung der ursprünglichen Ideen echter Leuchttürme, sehe ich nicht. Auch wenn der Förderalismus-Aspekt zurückträte, so wäre dies vielleicht umsetzbar, wenn drei eindeutige Spitzenreiter 1x im Süden, 1x im Westen und 1x im Osten liegen würden. Aber wenn man sich die Geschichte der ExIn/ExStra ansieht, dann ist ja offensichtlich, dass sowohl TUM als auch LMU dabei sein müssten, also gleich zwei aus dem Süden und sogar aus dem gleichen Bundesland. Und dies in einer Zeit mit einer bay. Wissenschaftsministerin. Obwohl die Fakten dafür sprächen, würde es ein
Geschmäckle bekommen. Also letztlich undenkbar.
#3 - Ein Aspekt fehlt mir in dieser Betrachtung vollständig
Ein Aspekt fehlt mir in dieser Betrachtung vollständig, nämlich, dass sich die gewünschte Leuchtturm-Exzellenz im wesentlichen an der Forschungsleistung orientiert. Das ist für eine Universität ein zumindest fragwürdiges Ziel, weil dabei die Lehre völlig aus dem Blick gerät. Man mag einwenden, dass gute Forschung Grundlage für für Lehre ist. Bei der von der Politik in Deutschland vorgesehenen hohen Lehrverpflichtung ist die Realität aber eher die, dass entweder gut geforscht oder gut gelehrt wird, nur selten beides (und oftmals auch keines davon). Wie kommt das ? Während bei den US Vorbildern jeweils eine Handvoll Studierende auf eine Lehrperson kommt und diese idR einen Kurs im Semester gibt, ist das Verhältnis in Deutschland deutlich schlechter und es müssen 4-5 Kurse im Semester gegeben werden. Harvard hat ca. ein Drittel der Studierenden einer beliebigen größeren deutschen Universität. Da sind wir also ohne jede Chance.
Und ja, die Exzellenzini richtet jede Menge Schaden an. An meiner Uni werden gerade 10% der Professuren eingespart. Ausgenommen sind jene, die eine "Teilnahme an einem Exzellenz Cluster Antrag" vorweisen können. Überleben werden also jene, die den irren bürokratischen Aufwand eines Antrags nicht gescheut haben - unabhängig von der Qualität der jeweiligen Ergebnisse in Forschung und oder Lehre. Keine guten Aussichten...
#4 - Der Autor hebt auf Universitäten der USA ab als unerreichbares
Der Autor hebt auf Universitäten der USA ab als unerreichbares Ideal und lobt eine Einzelmeinung eines Deutschen, der mal Ende der 1980er in Harvard studiert hat, weil der Autor die Meinung dieses Harvard-Alumnus teilt, Harvard spiele in einer anderen Liga. Kontostand und Qualität werden in eins gesetzt, Milliardäre sollen es retten. Ich sehe noch andere Faktoren als Geld am Werk. Was ist mit Großbritanniens Spitzenforschung an seinen staatlichen Universitäten - kann man aus der auch was lernen? 100,000 Genomes UK ist ein öffentliches Projekt der Spitzenforschung. Was ist mit Deutschlands Sonderweg, Spitzenforschung über lebenslange Berufungen an öffentlich finanzierte MPIs zu ermöglichen? Was ist mit jenen, die aus Harvard, Stanford nach Europa zurückkehren (z.B. Stanford nach Düsseldorf oder Harvard nach Basel)? Die ExStra zwingt teilnehmende Universitäten, ihre Leistungen nach dem von dfg und WR festgelegten Schema zu erfassen und zu berichten, damit können berichtete Leistungen verglichen werden. Sie erzielt damit, in meinen Augen, einen Effekt, der über das ausgeschüttete Geld hinaus wirksam ist.
#5 - Exzellenzinitiative und Wettbewerbsfähigkeit
Grundsätzlich stimme ich der Beobachtung zu, dass man in Deutschland lieber über die Mängel der ExIn/EXSTRA als über die im Weltmaßstab nicht ausreichende Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Wissenschaftssystem spricht.
Mir fehlt in der Betrachtung dabei aber erstens die Frage, ob es gut ist, gleichvolumig ein universitäres wie außeruniversitäres Forschungssystem in Deutschland zu finanzieren. Ein großer und immer wieder zu betonender Vorzug der ExIn ist hier in meiner Sicht, dass außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Universitären - unter finanzieller und oft auch inhaltlicher Führung der Universitäten - zur Zusammenarbeit angeregt/genötigt werden.
Zweitens ist auch zu fragen, ob wir globale Exzellenz immer wieder nur im nationalen Kontext erreichen und daran scheitern wollen oder ob wir hier nicht auch im EU-Maßstab denken. Die deutsche Wissenschaftspolitik fremdelt mit der EU und ist schon mit dem Bund-Länder-Komplex vollauf beschäftigt. Eine Europäische Exzellenzinitiative könnte aber auch im europäischen Wettbewerb dazu beitragen, die Spitzenuniversitäten und regionalen Wissenschaftszentren zu definieren, die in Deutschland mittel- bis langfristig global wettbewerbsfähig werden und möglichst bleiben sollen. Hier tut sich die nationale Wissenschaftspolitik jedoch ungeheuer schwer, auf europäischer Ebene kraftvoll einen Vorschlag zu plazieren und ihn dann im europäischen politischen Prozess in einer am Ende noch wiedererkennbaren Form durchzusetzen. Das "Window of opportunity" ist dafür jetzt offen wie selten. Verpassen wir es nicht.








Neuen Kommentar hinzufügen