"Das Problem ist nicht unsere mangelnde Stärke, sondern die Gefahr, sie zu verlieren"
Grünen-Wissenschaftspolitikerin Ayse Asar über Dorothee Bärs Hightech-Agenda, fehlende Prioritäten und warum große Versprechen das Wissenschaftssystem eher frustrieren als voranbringen.

Ayşe Asar (Bündnis 90/Die Grünen) ist seit 2025 Mitglied des Deutschen Bundestags und Fraktionssprecherin für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Foto: Grüne Bundestagsfraktion / Stefan Kaminski.
Frau Asar, ist Dorothee Bär eine gute Bundesforschungsministerin?
Man kann ihr zugutehalten, dass sie konstruktiv mit den Ländern arbeitet und den Dialog sucht. Aber gemessen an den realen Herausforderungen des Wissenschaftssystems überzeugt ihre Bilanz bislang nicht. Frau Bär produziert viel Glanz und Schlagzeilen rund um die sogenannte "Hightech-Agenda Deutschland", aber dahinter ist wenig Substanz zu erkennen – und kaum Ambitionen bei der Umsetzung. Gleichzeitig bleibt das "Brot-und-Butter-Geschäft", um einen Ausdruck der Ministerin zu benutzen, weitgehend liegen: von BAföG über Entbürokratisierung, Infrastruktur, Datenpolitik bis zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Auch bei strategischen Fragen wie der technologischen Souveränität oder der europäischen Forschungsförderung fehlen mir Tempo und Durchschlagskraft. Kurz gesagt: gute Atmosphäre, aber zu wenig klare Konzepte und zu wenig Politik aus einem Guss.
Und was ist für Sie gute Oppositionsarbeit?
Zum einen genau hinzuschauen. Das ist nicht einfach, weil es in der Kommunikation aus dem BMFTR oft an Transparenz fehlt: wenig Berichte, kaum Schriftliches, vieles läuft auf Zuruf. Zum anderen ist unser Anspruch als demokratische Opposition, mit eigenen Konzepten und Ideen zu arbeiten. Gerade arbeiten wir an einem großen Entbürokratisierungsantrag. Wir wollen mit konkreten Vorschlägen Druck machen, damit wirklich etwas passiert. Die Herausforderungen sind auch in der Wissenschaftspolitik so groß, wir müssen deutlich schneller werden.
Sie haben eben von der "demokratischen Opposition" gesprochen. Die größte Oppositionsfraktion ist die AfD. Macht das Ihre Rolle schwerer oder leichter?
Ich nehme die AfD nicht als konstruktive Opposition wahr. Sie ist wissenschaftsfeindlich, bringt keine eigenen Konzepte ein, sondern ist gegen Themen und stellt wissenschaftliche Fakten infrage. Gerade in der Wissenschaftspolitik kann man das nicht ernst nehmen. Ich sehe bei der AfD keinerlei Interesse, das Wissenschaftssystem stark, resilient und zukunftsgerichtet aufzustellen. Das lässt uns Grünen natürlich viel Raum. Aber daran kann ich nichts Positives finden. Der Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland erfüllt mich mit großer Sorge, auch für die dortige Wissenschaft.
Sie sind auffällig aktiv in den sozialen Medien und kommentieren dort pointiert die Wissenschaftspolitik.
Soziale Medien sind für mich als Oppositionspolitikerin ein wichtiges Instrument, um Erwartungsdruck aufzubauen und Themen sichtbar zu machen. Diese Räume den Extremen zu überlassen, wäre fatal. Das haben die Parteien der Mitte in den vergangenen Jahren ein Stück weit getan. Gleichzeitig kommt Wissenschaftspolitik in den klassischen Medien oft zu kurz und bleibt dadurch für viele Menschen sehr abstrakt. Wir haben als Politik – genauso wie der Journalismus – eine Verantwortung, diese Themen verständlich nach außen zu tragen. Wir sehen ja international, etwa in den USA, wie schnell der Eindruck entstehen kann: Wozu brauchen wir Wissenschaft überhaupt? Darum bespiele ich die Kanäle unterschiedlich: LinkedIn stärker für die Wissenschaftscommunity, Instagram für die breite Öffentlichkeit. Dorothee Bär ist übrigens ebenfalls sehr engagiert, vor allem auf Instagram, ich finde, das macht sie gut.
"Wir haben so viel Spielraum wie seit Langem nicht mehr,
doch dieser wird für Klientelpolitik und Wahlgeschenke eingesetzt."
Sie waren lange Landespolitikerin, haben als Staatssekretärin die Wissenschaftspolitik in Hessen geprägt. Jetzt sind Sie Bundestagsabgeordnete. Ändert das die Perspektive?
Ja, deutlich. Es macht einen Unterschied, ob man primär Landesinteressen vertritt oder nationale und europäische Interessen zusammendenkt. Ich sehe heute stärker die Verantwortung des Bundes, vor allem seine Koordinationsrolle. Es ist zu einfach, Zuständigkeiten immer weiter nach unten zu delegieren: Die Länder für die Grundfinanzierung der Hochschulen, der Bund für die Förderprogramme – und am Ende haben wir ein diffuses System, das weder resilient noch zukunftsfähig ist. Natürlich sehe ich die Haushaltsnöte auf allen Ebenen, auch beim Bund. Den Bund allerdings deshalb aus der Verantwortung zu entlassen, halte ich für falsch. Wir haben so viel Spielraum wie seit Langem nicht mehr, doch dieser wird für Klientelpolitik und Wahlgeschenke eingesetzt.
Sie haben vorhin als erstes die Hightech-Agenda erwähnt als Beispiel für Ambitionslosigkeit in der Umsetzung.
Auch schon bei ihrer Finanzierung! Von den 18 Milliarden Euro, mit denen die Hightech-Agenda beworben wird, sind faktisch nur 5,5 Milliarden wirklich neues Geld. Wenn ich Dorothee Bär wäre, hätte ich den Kanzler beim Wort genommen: Die Innovationspolitik soll Friedrich Merz zufolge höchste Priorität haben, wo ist dann die höchste Priorität im Haushalt? Im Koalitionsvertrag steht, dass bis 2030 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung in Forschung und Entwicklung gehen sollen, aber ich sehe keinerlei Bewegung in diese Richtung.
Hat Dorothee Bär nicht genug gekämpft?
Das kann ich nicht beurteilen, ich war ja nicht in den Haushaltsverhandlungen. Aber das Ergebnis überzeugt mich nicht. Und man sieht ja: An den Stellen, wo es der Ministerin wirklich wichtig ist, hat sie sich durchgesetzt. Die Mittel für die Gaming-Förderung sind von 50 Millionen Euro 2024 auf 125 Millionen Euro 2026 gestiegen. Diese zusätzlichen 75 Millionen Euro hätte man auch bei KI in der Hochschulbildung sehr gut einsetzen können, stattdessen wurde dieses Förderprogramm beendet. Alles eine Frage der Prioritätensetzung. Hinzu kommt ein Kernfehler, den die schwarz-rote Koalition insgesamt gemacht hat – und Dorothee Bär bei der Hightech-Agenda.
Und der wäre?
Zu große Erwartungen in zu kurzer Zeit zu wecken und sie dann nicht einlösen zu können. Das frustriert das System mehr, als realistisch zu starten.
Im Schüren hoher Erwartungen war auch die Ampel-Koalition unter Beteiligung der Grünen groß.
Es stimmt ja auch: Wir haben ein hochkomplexes föderales System, Prozesse dauern. Aber wenn man riesige Versprechen macht und nach 6 Monaten Unklarheit dann als erste Tat der Umsetzung mit den Ländern 16 Landesbeauftragte für die Hightech-Agenda vereinbart, wird genau diese Komplexität zum Sinnbild für das zu lösende Problem.
Hätten Sie als Landes-Staatssekretärin nicht dieselbe Forderung an den Bund gestellt?
Am Ende ist das immer eine Frage von Verhandlungen. Politik ist eine Kombination von Zuckerbrot und Peitsche. Auf der anderen Seite will jedes Land natürlich das Maximum für sich herausholen. Die Verantwortung des Bundes ist dann, nicht jedem alles zu geben – und schon gar nicht reflexhaft Bayern –, sondern zu entscheiden, was das Beste für uns als Bundesrepublik ist. Idealerweise eingebettet in eine europäische Strategie, damit es nicht verpufft, sondern ein ganzheitliches Konzept ergibt.
"Mir ist die Selbstvergewisserung wichtig.
Wir müssen aufhören, alles schlechtzureden."
Wie könnte das BMFTR jetzt Tempo machen?
Das wird schwierig angesichts der zersplitterten Strukturen: Es gibt Beratungsgremien beim Kanzler, bei der Wirtschaftsministerin mit einem ganz anderen Ansatz und zusätzlich beim Forschungsministerium. Am Ende kann kein Ministerium in der Innovationspolitik die Weisheit allein für sich beanspruchen. Daher war ja das Versprechen der Innovationspolitik aus einem Guss so wichtig, wurde aber wieder überlagert durch das Ressortdenken. Es braucht natürlich auch die Expertise der Wissenschaft und der Unternehmen – und einen engen, kontinuierlichen Austausch, um gemeinsam tragfähige Konzepte zu erarbeiten. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und die muss zügig und strukturiert ablaufen.
Die Hightech-Agenda ist die deutsche Reaktion auf die veränderte geopolitische Lage. Sie haben kürzlich auf LinkedIn gepostet: "China und die USA brauchen uns mehr, als wir dachten." Was meinten Sie damit?
Die EU hat systematisch analysiert, in welchen Technologien andere von uns Europäern abhängig sind. Das ist ein wichtiger Schritt, weil wir international lange zu naiv unterwegs waren. Als Deutsche und Europäer haben wir in bestimmten Bereichen technologische Führungspositionen, die müssen wir bewusst sichern. Ohne die Produkte von ASML oder Zeiss könnten weder China noch die USA KI-Chips produzieren, und auch in der Luft- und Raumfahrt ist China zu 98 Prozent abhängig von EU-Komponenten. Nur zwei Beispiele unter vielen. Wir dürfen uns nicht überholen lassen und müssen dieses Wissen auch strategisch nutzen, etwa in Handels- und Zollverhandlungen.
Eine neue Logik der gegenseitigen Abschreckung: Bedroht ihr uns mit Technologieentzug, antworten wir mit Technologieentzug?
Ich glaube, man muss beides machen. Wir müssen dort, wo unsere Abhängigkeiten besonders groß sind, vor allem im Digitalbereich, sehr schnell eigene Souveränität aufbauen. Das geht nur mit gezielten Investitionen und keinesfalls von heute auf morgen. Das ist wie bei der Verteidigungsfähigkeit: Natürlich ist die NATO zentral, und wir müssen alles dafür tun, dass sie Bestand hat. Aber wir müssen auch vorsorgen für den Fall der Fälle – etwa durch eine stärkere europäische Verteidigungsfähigkeit. Gleichzeitig ist mir die Selbstvergewisserung wichtig. Wir müssen aufhören, alles schlechtzureden.
Und selbstzufriedener sein?
Das meine ich nicht. Wir haben ein sehr starkes Wissenschafts- und Innovationssystem und sind in vielen Bereichen nach wie vor spitze. Das Problem ist nicht unsere mangelnde Stärke, sondern die Gefahr, sie zu verlieren – durch Einsparungen, bröckelnde Infrastruktur und fehlende strukturelle Weiterentwicklung. Diese Erosion dürfen wir nicht zulassen.
Ein starkes Innovationssystem braucht den Zustrom internationaler Talente. Das BMFTR hat das "1000-Köpfe-Plus"-Programm aufgelegt. Ein Erfolg?
Die entscheidende Frage lautet: Was ist das Ziel dieses Programms? Ausgangspunkt waren die Entwicklungen in den USA und die Idee, ein sicherer Hafen für bedrohte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu sein. Wenn man sich die Zahlen anschaut, kommen aber die meisten Geförderten weder aus den USA noch aus dem globalen Süden, sondern aus Europa. Wir machen uns also selbst innerhalb Europas Konkurrenz und der Schutzaspekt spielt praktisch eine untergeordnete Rolle.
Aber die Talente kommen?
Positiv finde ich, dass das BMFTR keine Parallelstrukturen geschaffen hat, sondern auf bewährte Organisationen wie die DFG oder die Humboldt-Stiftung setzt. Aber es fehlt an Nachhaltigkeit, das Programm droht gerade für junge Forschende zum Strohfeuer zu werden: Sie werden angelockt, doch dann fehlt es an verlässlichen Perspektiven und Dauerstellen. Ohne eine Mittelbaustrategie und den Aufbau flächendeckender Departmentstrukturen werden wir die Talente verlieren: die neuen, die jetzt zu uns kommen – und diejenigen, die schon längst hier sind.
Nur dass für mehr Dauerstellen in der Wissenschaft die Länder verantwortlich sind – und frühere Wissenschaftsstaatssekretärinnen wie Sie.
Ich finde, unser Kodex für gute Arbeit in Hessen war ein gutes Regelwerk. Den haben wir mitten in der Pandemie ausgehandelt, komplett online, mit Personalvertretungen und Hochschulleitungen, unter extrem schwierigen Bedingungen. Und unser Pakt, den wir mit den Hochschulen geschlossen hatten, sah jährliche Steigerungen von vier Prozent vor. Die Vereinbarung der Nachfolgeregierung bedeutet dagegen massive Einsparungen. Denn natürlich haben Sie Recht: Der Bund kann einiges machen mit dem 1000-Köpfe-Programm oder einer Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, solange die Hochschulen keine ausreichende Finanzierung haben, greifen solche Instrumente nur begrenzt.
Hessen ist nicht das einzige Land in Haushaltsnöten. Wollen Sie sagen, dass Sie in derselben wirtschaftlichen Lage nicht gespart hätten an den Hochschulen?
Am Ende ist auch das eine Frage demokratischer Prioritätensetzung. In Hessen fließt derzeit viel Geld in Programme für Häuslebauer und junge Familien, die eine erste Immobilie erwerben wollen. Dieses Geld könnte man genauso gut in Bildung investieren.
Im selben Absatz wie das 1000-Köpfe-Programm verkündet der schwarz-rote Koalitionsvertrag: "Wissenschaftlich relevante Datenbestände, deren Existenz bedroht sind, wollen wir weltweit sichern und zugänglich halten." Auch dies als Reaktion auf die wissenschaftsfeindlichen Tendenzen in den USA. Passiert da genug?
Forschungsdaten sind der wichtigste Rohstoff für Innovationen, und es passiert viel zu wenig. Das beginnt beim Forschungsdatengesetz: Die Ampel hatte einen Entwurf, der ist mit dem Koalitionsbruch liegen geblieben. Jetzt heißt es, es gebe Ressortanhörungen und man wolle das alte Konzept übernehmen. Gleichzeitig blockieren Ressortstreitigkeiten erneut alles.
Nochmal: Wie schon in der Ampel.
Das ist hochproblematisch. Hinzu kommt, dass Mittel für die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) aus dem Kernhaushalt ohne Not ins Sondervermögen verschoben wurden, um an anderer Stelle Spielräume zu schaffen. Oder nehmen Sie das deutsche Verhalten im europäischen Wettbewerb um die AI Gigafactories: Es gab aus Deutschland im letzten Jahr fünf Interessensbekundungen, weil die Bundesregierung diesen Prozess nicht besser koordiniert hat. Und wer die Kosten für den laufenden Betrieb übernehmen soll, ist offen. Dabei können wir uns diese Langsamkeit gerade beim Thema KI nicht leisten.
"Nicht jede Forschungsorganisation soll alles machen.
Darum brauchen wir klarere Zielvereinbarungen und treffsichere Evaluationen."
Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern hat darum KI zum Gegenstand des ersten Paktforums gemacht. Im Paktforum sollen die großen außeruniversitären Forschungsorganisationen sich strategisch besser abstimmen und im Gegenzug für ihre Bund-Länder-Finanzierung neue gemeinsame Initiativen auf den Weg bringen. Mehr Impact fürs gleiche Geld, könnte man sagen. Wie passt dazu, wenn Max-Planck-Präsident Patrick Cramer gleichzeitig 500 Millionen Euro extra speziell für seine Gesellschaft fordert?
Grundlagenforschung und Wissenschaftsfreiheit sind die Basis für alles Weitere, die darf man nicht schwächen. Max Planck leistet exzellente Forschung und ist im internationalen Wettbewerb wichtig für die Bundesrepublik.
Aber Max Planck und die anderen Forschungsorganisationen sind doch über den Pakt für Forschung und Innovation (PFI) bereits privilegiert, der ihnen jährlich drei Prozent Budgetplus garantiert.
Man sollte dennoch nicht so tun, als schwömmen die Organisationen im Geld: Inflation, Tarifsteigerungen und zusätzliche Aufgaben fressen große Teile der Zuwächse auf. Deshalb braucht es eine Fortführung des PFI, der diese Bedarfe deckt. Aber klar ist auch, dass von 2027 an massive Einsparvorgaben im Bundeshaushalt anstehen. Die Lücke wächst bis zum Ende der Legislaturperiode auf über 70 Milliarden Euro an. Vor diesem Hintergrund geht es um die Frage, wie wir das Gesamtsystem zukunftsfähig aufstellen und politisch steuern.
Ist das ein Plädoyer für mehr Priorisierung? 500 Millionen extra für Max Planck – und die anderen gehen leer aus?
Da verstehen Sie mich falsch. Unser Wissenschaftssystem ist gut austariert und lebt von komplementären Profilen. Nicht jede Organisation soll alles machen. Darum brauchen wir klarere Zielvereinbarungen, treffsichere Evaluationen, die, anstatt nur Publikationen oder Start-ups zu zählen, die Frage beantworten, was unser Wissenschafts- und Innovationssystem wirklich weiterbringt.
Und wenn eine Organisation nicht liefert, bekommt sie weniger Geld?
Forschung braucht Planungssicherheit und Verlässlichkeit. Ein lernendes System mit Anreizen, punktuellen Korrekturen und realistischen Erwartungen ist sinnvoller als harte Kürzungen von heute auf morgen.
Jetzt hören Sie sich fast so wenig priorisierend an, wie Sie es sonst der Bundesregierung vorwerfen. Und an einer Stelle möchte ich es doch nochmal genauer wissen: Auf LinkedIn haben Sie neulich kritisiert, dass die DFG unterfinanziert sei, dass die drei Prozent Zuwachs extra pro Jahr, die sie als PFI-Organisation erhält, nicht ausreichten. Plädieren Sie wirklich für noch mehr Drittmittel, wenn gleichzeitig die Grundhaushalte der Hochschulen stagnieren und der Drittmittelanteil schon vor der aktuellen Krise auf Rekordniveau lag?
Die Leistungen der DFG haben einen großen Wert für das deutsche Wissenschaftssystem. Dass es ein massives Missverhältnis zwischen Drittmitteln und Grundfinanzierung gibt, gerade weil die Länder bei den Hochschulen weiter sparen, ist unstrittig und ein großes Problem. Aber die Antwort kann aus meiner Sicht nicht sein, das System und die Organisationen gegeneinander auszuspielen.
Man könnte doch sagen: Das Plus bei der DFG wird begrenzt, und das gesparte Geld fließt zusätzlich in den "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken", also in die Grundfinanzierung der Hochschulen.
Das ist mir zu defizitorientiert gedacht. Wenn der Bund für Dinge wie die Mütterrente vier Milliarden Euro pro Jahr findet, ohne dass das einen strukturellen Zukunftseffekt hat, dann halte ich es für falsch, im Wissenschaftssystem zu überlegen, wo man etwas wegnehmen muss, um woanders etwas aufzubauen. Der Zukunftsvertrag muss weiter dynamisiert werden, dafür werde ich mich einsetzen. Aber ihn zu stärken, indem man an anderer Stelle kürzt, überzeugt mich nicht. Wir müssen bei den Drittmitteln auf anderer Ebene ansetzen.
Auf welcher?
Die zunehmende Drittmittelfinanzierung erzeugt enorme Bürokratie, Antragswust, Nachweise, Berichte. Das ist ineffizient, weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen sollen – und nicht Formulare ausfüllen. Dafür liegen seit Jahren gute Vorschläge auf dem Tisch, und daraus haben wir jetzt unseren Entbürokratisierungsantrag gemacht, den ich anfangs erwähnt habe. Meine Losung ist in der Hinsicht ganz einfach, und ich zitiere CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann: Einfach mal machen. Als erste Maßnahme einen Entbürokratisierungsbeauftragten einzusetzen, wie das Dorothee Bär getan hat, ist mir angesichts der vorhandenen Problemanalyse zu wenig.
"Es sind viele Hebel, aber der wichtigste Hebel ist,
den Anteil der verlässlichen Grundfinanzierung für
Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu erhöhen."
Nennen Sie doch mal Ihre drei Lieblingshebel bei der Entbürokratisierung für Wissenschaft und Hochschulen.
Es sind viele Hebel, aber der wichtigste Hebel ist, den Anteil der verlässlichen Grundfinanzierung für Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu erhöhen. Ein weiterer Punkt, der jetzt nicht sexy klingen mag, ist die Lösung der Umsatzsteuerproblematik. Die Auftragsforschung an den Hochschulen ist in den vergangenen zehn Jahren massiv zurückgegangen. Das liegt auch daran, dass Hochschulen für ihre Dienstleistungen Umsatzsteuer berechnen müssen, und die teilweise viel zu enge Auslegung des EU-Beihilferechts. Und wenn wir schon aus Kosten- und Effizienzgründen wollen, dass Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen sich Labore und Forschungsinfrastrukturen teilen, wie passen dazu steuerliche und administrative Regeln, die das unnötig verkomplizieren. Beim EU-Beihilferecht neigen wir dazu, noch eine Schippe draufzulegen. Weniger Bürokratie wäre nicht nur Effizienzgewinn, sondern würde auch helfen, den gesellschaftlichen Wert von Wissenschaft stärker sichtbar zu machen.
Was ist mit dem BAföG?
Da geht es um beides: um Entbürokratisierung und um inhaltliche Reformen. Zum Beispiel sollten Personendaten, die einmal bei der Antragstellung angegeben wurden, auch für automatische Verlängerungen genutzt werden, statt jedes Jahr neue Anträge zu verlangen. Und was die inhaltlichen Reformen angeht: Die Wohnkosten müssen realistisch an den Mietspiegel angepasst werden und entsprechend dem Mietspiegel steigen. Und die Freibeträge müssen so hoch sein, dass auch Studierende aus der Mittelschicht eine Förderung erhalten können. Das ist keine Ausgabe ohne Wirkung, sondern eine Investition. Diese jungen Menschen sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler von morgen – und deshalb sollte man hier nicht mit zu kleinen Würfen arbeiten.
Frau Asar, wenn Sie aus Ihrem Bürofenster schauen, sehen Sie die russische Botschaft. Was geht Ihnen da als Wissenschaftspolitikerin durch den Kopf?
Wissenschaft lebt von Internationalität, das war immer ihre Grundlage. Und genau diese Grundlage gerät zunehmend unter Druck, durch Nationalismus, durch politische und militärische Aggressionen. Zugleich sehen wir in Russland, aber auch anderswo, wie Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt wird, wie Fakten politisch unter Druck geraten. Davor sind auch wir in Deutschland nicht automatisch geschützt. Deshalb müssen wir lernen: aus den Entwicklungen in den USA ebenso wie aus autoritären Systemen. Wissenschaft muss viel klarer zeigen, welchen gesellschaftlichen Wert sie hat. Fakten sind die Basis von Demokratie. Wenn wir wollen, dass unsere Gesellschaften auch in Zukunft resilient sind, dann müssen wir die Wissenschaft jetzt stärken – mit aller Kraft, die wir haben!





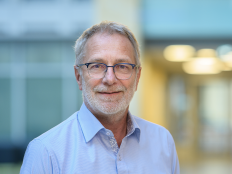
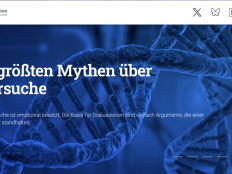

Neuen Kommentar hinzufügen